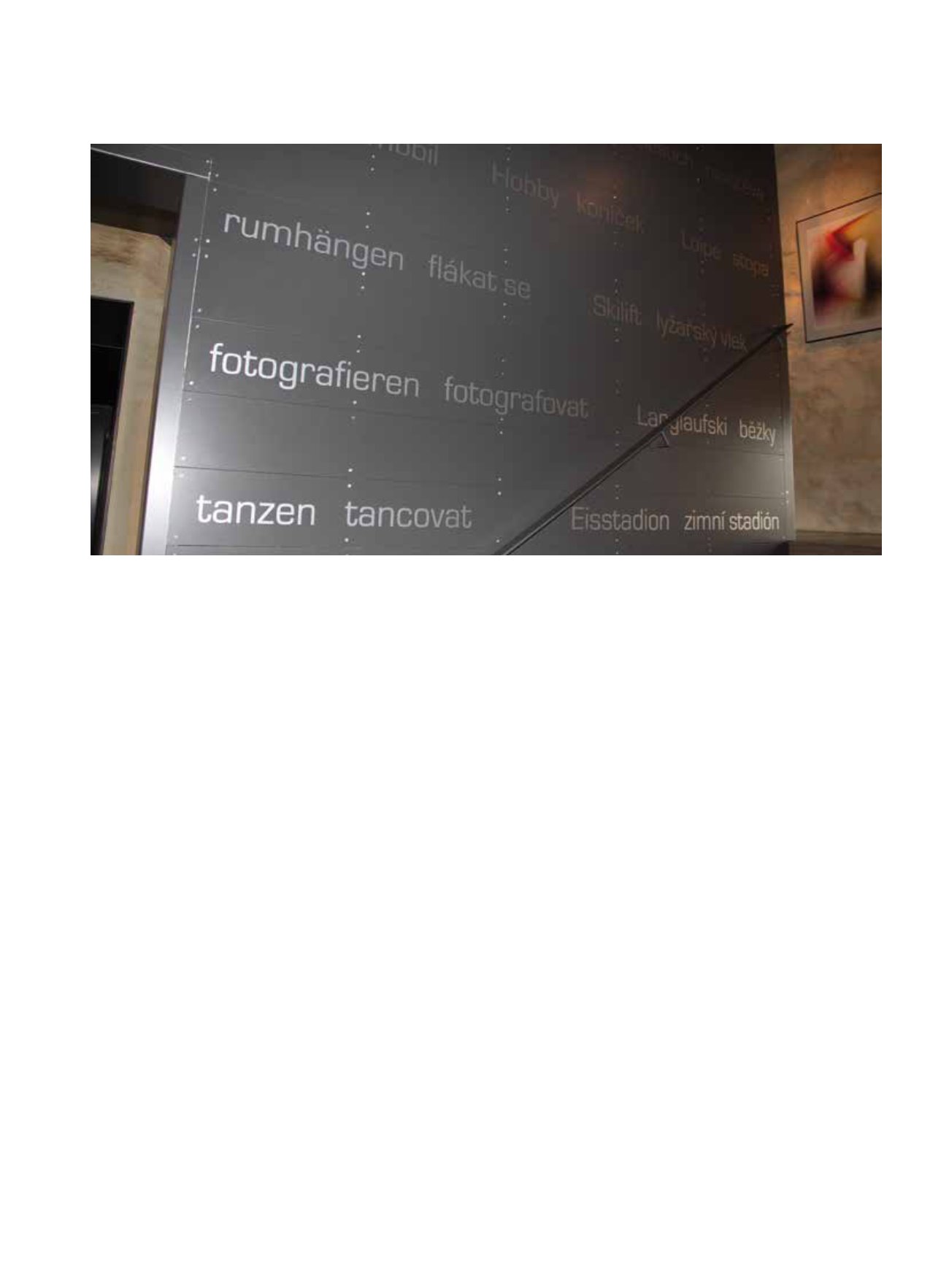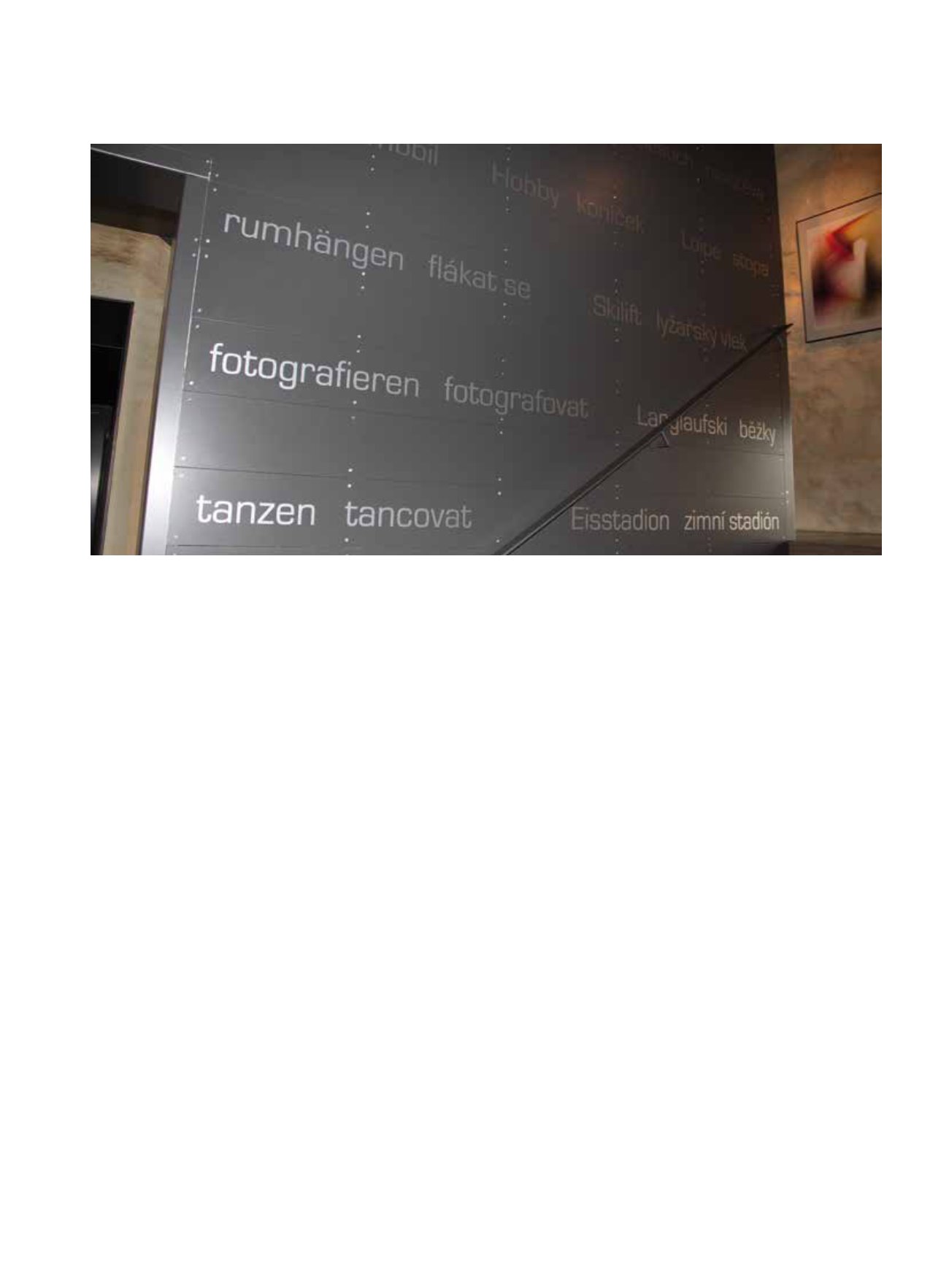
aviso 2 | 2015
Böhmen und Bayern
Werkstatt
|40|
»Also [Projekt X] war von vornherein zweisprachig konzi-
piert, da gab’s ä immer Diskussionen, […] durch die Zwei-
sprachigkeit is[t], wird natürlich der Platz geringer, auf der
andern Seite:, hab i[ch] g’sagt, ich will net locker lass’n von
der Zweisprachigkeit also
wirklich
der
tatsächlich’n Zwei-
sprachigkeit,
weil’s weil’s halt einfach [ein] Alleinstellungs-
merkmal für [Projekt X] is[t] und, und wir, wir sin[d]
[ein] Projekt, das von
vornherein
eb’n
die Zweisprachigkeit
auf die Fahnen g’schrieb’n
hat […]« (Kult01 Interview 02;
Transkription vereinfacht, Hervorhebung durch den Verfasser)
Das ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl von Interviews, die im
Rahmen des Verbundprojektes »Komplexitätsmanagement
durch geisteswissenschaftliche Expertise: Übersetzungszwänge
und -praxen von Organisationen in der bayerisch-böhmi-
schen Grenzregion« aufgenommen wurden und die unmit-
telbar eine Reihe von Fragen aufwerfen: Warum legt man
eine solche Betonung auf die Zweisprachigkeit und warum
werden andere Formen der sprachlichen Grenzüberschrei-
tung zurückgestellt? Wie wirken sich die Planung einer »tat-
sächlichen Zweisprachigkeit« auf konkrete Interaktionen in
der internen und externen Kommunikation und die Akquise
des Personals aus? Welche Funktion hat die »tatsächliche
Zweisprachigkeit« von Dokumenten und der Selbstreprä-
sentation der Organisation imHinblick auf Umsetzung ihrer
Ziele, Herstellung ihrer Identität und Erschließung von För-
derressourcen? Und was ist in der Fokussierung der Gren-
ze und ihrer Über-Setzung für untersuchte Organisationen
an der sprachlichen und territorialen Grenze spezifisch und
was ist im Hinblick auf den Umgang mit Mehrsprachigkeit
und den Wandel im Umgang mit der sprachlichen und kul-
turellen Homogenität und Heterogenität allgemein gültig?
Grenzüberschreitung als Forschungsobjekt
Solche und ähnliche Fragen stellte man sich imRahmen des
Projektes, das vomBundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert und am Bohemicum von Christoph Marx
und Marek Nekula zusammen mit den Mitarbeitern der In-
stitute für Pädagogik und Soziologie der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt wurde.
Das Forschungsinteresse des Projektes ergab sich aus den
mit der Europäisierung und Globalisierung wachsenden all-
täglichen Herausforderungen der Überschreitung nationaler,
kultureller und sprachlicher Grenzen. Paradigmatisch hierfür
standen Grenzregionen und dort insbesondere jene Organi-
sationen, die neben der Bearbeitung ihrer jeweiligen ökono-
mischen, politischen oder anderen Ziele ausdrücklich mit
der Überschreitung solcher Grenzen beauftragt und befasst
sind. Das Forschungsprojekt untersuchte Organisationen in
der deutsch-, bzw. bayerisch-tschechischen Grenzregion, die
grenzüberschreitende Zielsetzungen inmitten lokaler Um-
stände erreichen sollen bzw. wollen. Solche »Grenzorgani-
sationen« werden mit vielfältigen Übersetzungsanforderun-
gen zwischen unterschiedlichen Sprach- und Rechtsräumen,
Arbeits- und Wissenskulturen sowie nationalkulturellen
Erfahrungszusammenhängen konfrontiert. Dabei treten auch
harte »Grenzen der Grenzüberschreitung« zutage, die von
Text:
Marek Nekula
an der Grenze über die Grenze
Zur Forschung am Bohemicum Regensburg-Passau
Foto: Nicolas Engel & Christoph Marx. Rechte zum Foto bei den Autoren
oben
Installation »Sprache im Raum«.