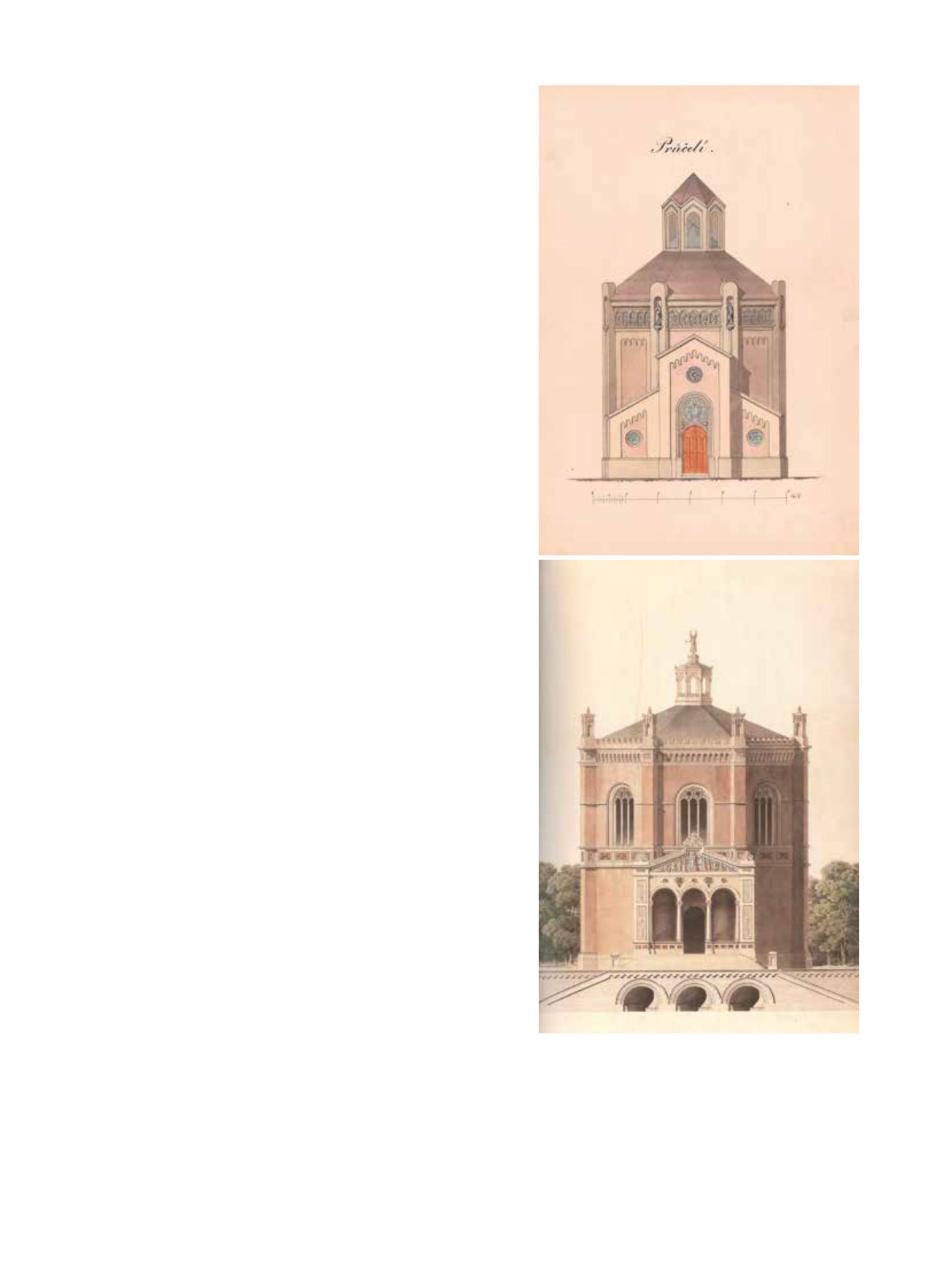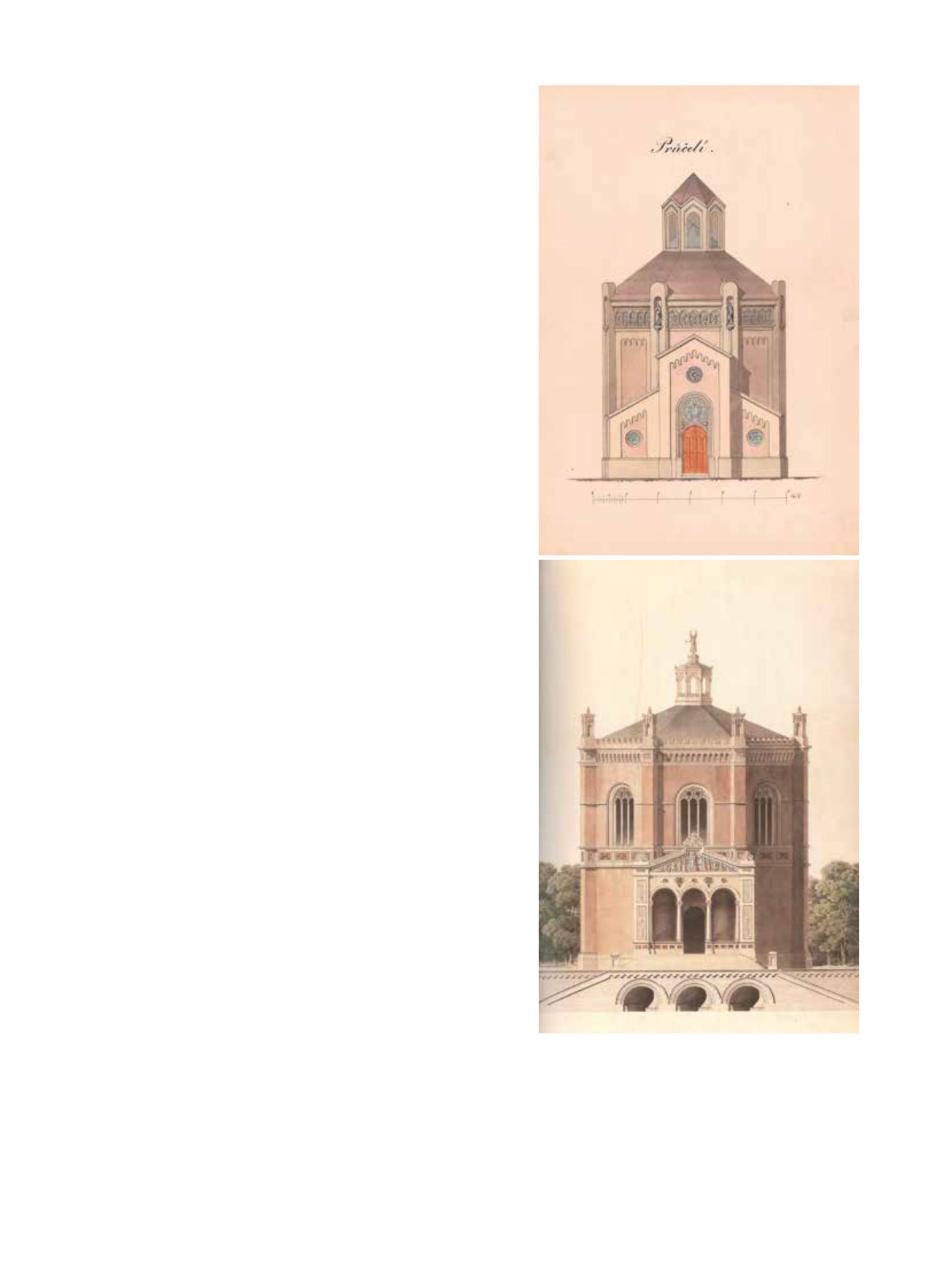
|45 |
aviso 2 | 2015
Böhmen und Bayern
Werkstatt
Professor Dr. Marek Nekula
ist seit 1998 Professor für Bohemistik
und Westslavistik an der Universität Regensburg und Leiter des Bohemicum
Regensburg-Passau; 2006 und 2012 senior & visiting fellow am Davis
Center for Russian and Eurasian Studies der Harvard University; seit 2012
Mitglied des Vorstands der Graduiertenschule für Ost- und Südost-
europastudien (LMU München & Universität Regensburg).
Zum Weiterlesen
Boris Blahak: Franz Kafkas Literatursprache: Deutsch im Kontext des Pra-
ger Multilingualismus. Köln, Weimar: Böhlau, 2015.
Klaas-Hinrich Ehlers, Marek Nekula, Martina Niedhammer, Hermann
Scheuringer (Hgg.): Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa:
Institutionalisierung und Alltagspraxis. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2014.
Nicolas Engel, Michael Göhlich, Thomas Höhne, Matthias Klemm, Clemens
Kraetsch, Christoph Marx, Marek Nekula, Joachim Renn: Grenzen der
Grenzüberschreitung: Zur »Übersetzungsleistung« deutsch-tschechischer
Grenzorganisationen. Bielefeld: Transcript, 2014.
Ausblick
Besonders in den letztgenannten Projekten wird in der sprachlichen
Grenze auch die kulturelle Grenze mit angesprochen. Mit Benedict
Anderson gesprochen, sind schließlich die Grenzen der Sprache auch
Grenzen der kollektiven Solidarität, im kultursemiotischen Sinne ist
die Grenze für eine Kultur sowie auch für die Kultur im Allgemeinen
konstitutiv. Zentraleuropa war und ist von sprachlicher und kultureller
Pluralität, Heterogenität und Differenz geprägt, es bildet eine Semio-
sphäre, die von Grenzen durchzogen und bestimmt wird. Die Grenze
verbindet aber auch, ist immer zwei- oder mehrsprachig, sodass sich
individuelle und kollektive Identitäten in einem permanenten Prozess
der Verhandlung und der Re-Konstruktion befinden. Von den Grenzen
sind auch Erinnerung und Gedächtnis, die bei der Konstruktion von
kollektiven Identitätsentwürfen und bei deren Legitimierung für die
Zukunft eine zentrale Rolle spielen, bestimmt. So entsteht im langen
19. Jahrhundert etwa die
Walhalla
als Bezeichnung für eine deutsche
Ruhmeshalle sowohl in Anlehnung als auch in Abgrenzung zum römi-
schen und französischen
Pantheon
: der kollektive Erinnerungsraum
wird auch durch die Über-Setzung seiner Bezeichnung zum Ausdruck
der Konkurrenz zwischen Romanitas und Germanitas. Ähnlich trifft
dies auch für die
böhmische Walhalla
und den tschechischen
Slavín
zu,
die zwar direkt, bzw. semantisch aus dem Deutschen entlehnt wurden,
sich aber sprachlich und ideell davon absetzen. Zudem sind in den bei-
den Bezeichnungen Mehrdeutigkeit und Widersprüchlichkeit der Re-
gion eingeschrieben. Man kann die Bezeichnung und Einrichtung der
böhmischen Walhalla
und des
Slavín
territorial und sprachübergrei-
fend (böhmisch) als »Ruhmeshalle« oder sprachnational und trennend
(tschechisch) als »Ort des slawischen Ruhmes« deuten, bevor sich beim
Slavín
schließlich die tschechische, slawische Lesart durchsetzte. Darauf
sowie auf die Rolle des Todes und seiner symbolischen Überwindung
durch historische Narrative, Begräbnisrituale und daraus entstandene
Repräsentationsformen und -praxen geht das DFG-Projekt »Tod und
Auferstehung einer Nation: Das Pantheon Slavín in der tschechischen
Literatur und Kultur« ein, das am Bohemicum angesiedelt war und zu
dem demnächst eine Monographie erscheint. Auch andere Publikatio
nen und Projekte des Bohemicum zielen auf die Mehrdeutigkeit,
Widersprüchlichkeit und Konkurrenz von Erinnerungsnarrativen ab,
wie es sie auch im 20. und 21. Jahrhundert gibt, und bilden – neben
dem Management der Mehrsprachigkeit und dem Sprachkontakt
und -vergleich – einen weiteren Forschungsschwerpunkt des Bohemicum.
Mit freundlicher Genehmigung des Archivs Akademie veˇd Cˇ R, Fond Svatobor | Mit freundlicher Genehmigung der Staatlichen Graphischen Sammlung, München
oben
Entwurf des Pantheons Slavín von Václav Šalanda
aus dem Jahre 1862. Archiv Akademie veˇd Cˇ R, Fond
Svatobor, Karton 78, Inventar-Nr. 466.
darunter
Bayerische Ruhmeshalle, Wettbewerbsentwurf
von Leo von Klenze aus dem Jahre 1834;
26988, Staatliche Graphische Sammlung, München.