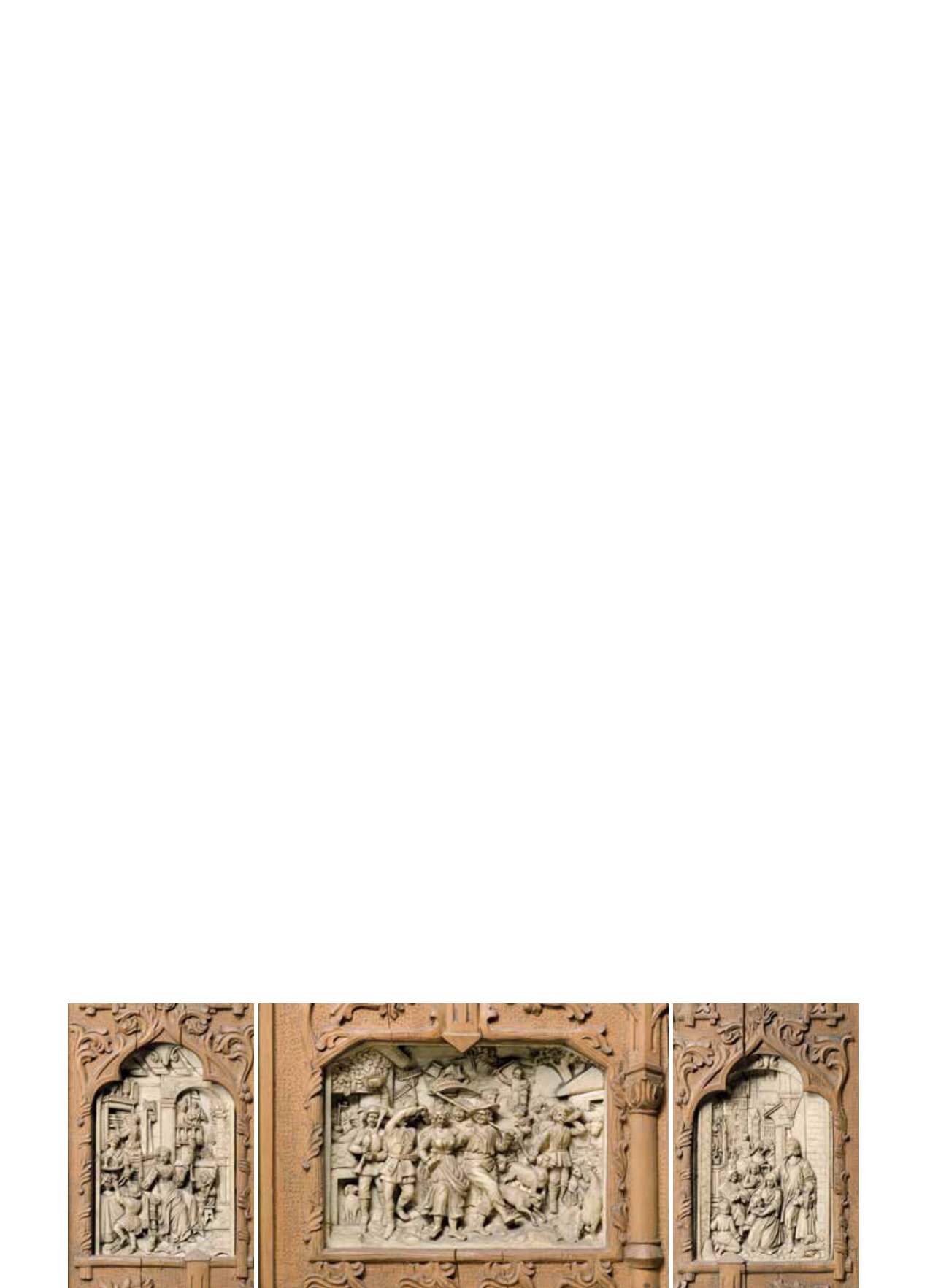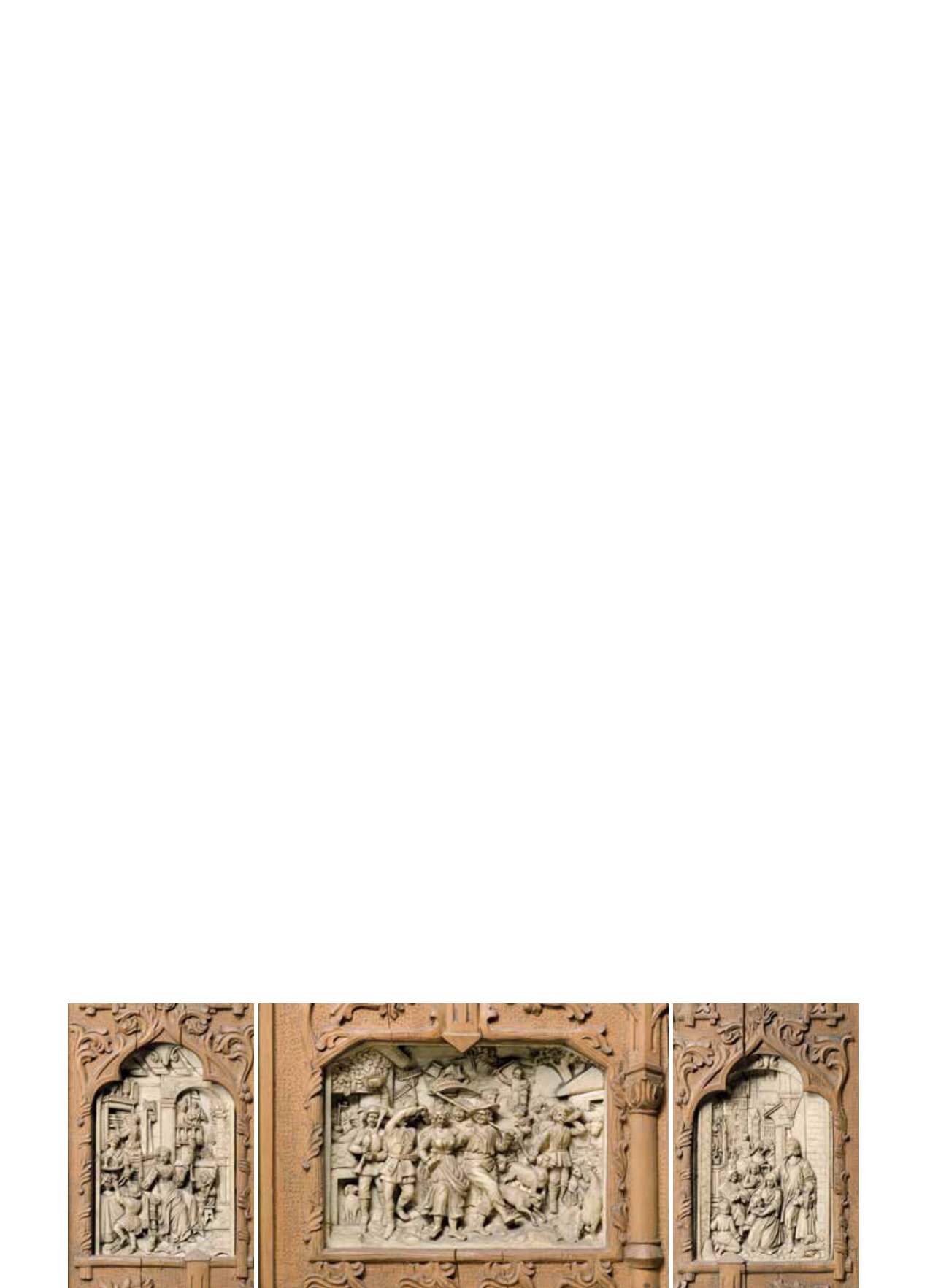
(1900–1946) im »Generalgouvernement für die besetzten pol-
nischen Gebiete« avancierte, folgte ihm der von Hermann
Göring (1893–1946) zum»Sonderbeauftragten für den Schutz
und die Sicherung von Kunstwerken in den besetzten Ostge-
bieten« ernannte Mühlmann. Nachdem Hitler 1940 Seyß-
Inquart zum »Reichskommissar für die besetzten niederlän-
dischen Gebiete« berufen hatte, gründete Mühlmann in Den
Haag die auf Kunstraub und die Verwertung geraubter Kunst-
werke spezialisierte »Dienststelle Dr. Mühlmann«. Neben der
Zentrale in Den Haag unterhielt sie Dependancen in Brüssel
und Paris. Allein die über die niederländische Dienststelle ab-
gewickelten Kunsttransaktionen beliefen sich auf ca. fünf Mil-
lionen Gulden. Zu seinen NS-Kunstraub-Aktivitäten wurde
der von den Alliierten nicht angeklagte Kajetan Mühlmann
nach Kriegsende in Altaussee befragt; die Protokolle wurden
im Dezember 1945 von Jean Vlug zusammengestellt. Zu den
im »Vlug«-Report enthaltenen Dokumenten gehören auch
umfangreiche Listen der von Mitarbeitern der »Dienststelle
Mühlmann« in den besetzten Ländern geraubten und verkauf-
ten Kunstwerke, darunter auch ausführliche Verzeichnisse der
nach München an Weinmüller gelieferten Objekte. Unter die-
sen Kunstwerken befindet sich auch »1 bronze, Renaissance«
aus der Amsterdamer Sammlung Hamburger, zu der es im
»Vlug«-Report heißt: »In 1941 indicated by the Dienststelle
as Enemy Property, registered and estimated (Dr. Plietzsch)
and converted into money.« In der am 8. Juni 1942 im Auf-
trag von KajetanMühlmann ausgefertigten Generalvollmacht
»wird bescheinigt, dass der Inhaber des Münchener Kunst-
versteigerungshauses, Herr Adolf Weinmüller, mit meinem
Einverständnis und meiner Einwilligung in den besetz-
ten niederländischen Gebieten Kunsteinkäufe durchführt.
Gegen die Ausfuhr der Kunstgegenstände ins Reich wird
keine Einwendung erhoben.«
Adolf Weinmüller (1886–1958) hatte unmittelbar nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Auf-
trag der Reichsleitung der NSDAP die Gleichschaltung des
»Verbandes des deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels«
und damit die Liquidierung aller anderen, insbesondere der
jüdischen Kunsthändlervereinigungen organisiert. Als Vor-
sitzender des »Bundes der deutschen Kunst- und Antiqui-
tätenhändler« propagierte er den »Kunsthandel im Neuen
Staate« und wirkte maßgeblich am »Gesetz über das Verstei-
gerergewerbe« mit, durch das Juden aus diesemWirtschafts-
zweig ausgeschlossen werden sollten. In der Folge übernahm
Weinmüller, der sich bereits 1924 in München mit der Firma
»Alte und Neue Kunst« als Kunsthändler selbständig gemacht
hatte, den Kunstmarkt und erlangte eine Monopolstellung im
Kunsthandel des »Dritten Reiches«. 1936 eröffnete Weinmül-
ler imPalais Leuchtenberg das in der ehemaligen »Hauptstadt
der Deutschen Kunst« konkurrenzlose »Münchener Kunst-
versteigerungshaus Adolf Weinmüller«; 1938 gründete er in
Wien ein zweites Auktionshaus und »arisierte« das jüdische
»Kunstantiquariat und Auktionshaus S. Kende«. Weinmüller
war ein skrupelloser Profiteur des Nationalsozialismus, der
die politischen Verhältnisse geschickt für seine Zwecke aus-
nutzte. Im gegen ihn angestrengten Entnazifizierungsver-
fahren wurde er 1948 lediglich als Mitläufer eingestuft. Die
US-amerikanischen Kunstschutzoffiziere Edgar Breitenbach
und Stefan P. Munsing vom Münchner »Central Collecting
Point« konnten nicht verhindern, dass Weinmüller bereits
1949 in München seine Tätigkeit als Auktionator wieder auf-
nahm und dann bis zu seinem Tod erfolgreich weiterführte.
ZUM AUFGABENGEBIET DER
Provenienzforschung ge-
hört auch die systematische Überprüfung von Objekten, die
in Dauer- oder Sonderausstellungen gezeigt werden sollen.
Da die aus den Königlichen Sammlungen der Wittelsbacher
stammende Florentiner Prunkkassette für die Neueinrich-
tung der Barockabteilung des Bayerischen Nationalmuse-
ums vorgesehen ist, geriet auch der Triton in den Fokus der
Recherche. Nachdem seine belastete Provenienz jetzt zweifels-
frei feststeht, ist er nun bereits abmontiert worden, um jeder-
zeit problemlos zurückgegeben werden zu können.
Schillers »Lied von der Glocke«
Zu den im Bayerischen Nationalmuseum verwahrten kunst-
handwerklichen Objekten des Historismus gehört eine um
1840/1850 in Süddeutschland entstandene hochrechteckige,
oben abgerundete Tafel aus Eichenholz mit den wichtigsten
Episoden aus Friedrich Schillers 1799 vollendetem Gedicht
»Das Lied von der Glocke« (BNM, Inv.-Nr. 55/124). In die
Holztafel sind neun kleine, reich mit neugotischem Ast- und
Laubwerk gerahmte sowie von Architekturgliedern mit
bekrönenden Engelsfiguren flankierte Bas-Reliefs wechseln-
den Formats aus Elfenbein eingesetzt. Die programmatisch
ausgewählten Reliefszenen aus demmit insgesamt 425 Versen
längsten Gedicht Schillers zeigen von links oben nach rechts
unten: Hochzeitspaar, Taufe, Leichenzug, Hausfrau am Spinn-
rocken, Kirchgang und Almosenspende, Feuersbrunst und
Zählen der Häupter, Erntefeier, Meister mit Glocke, Aufruhr.
© Bayerisches Nationalmuseum München, Fotos: Walter Haberland