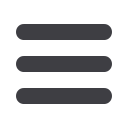
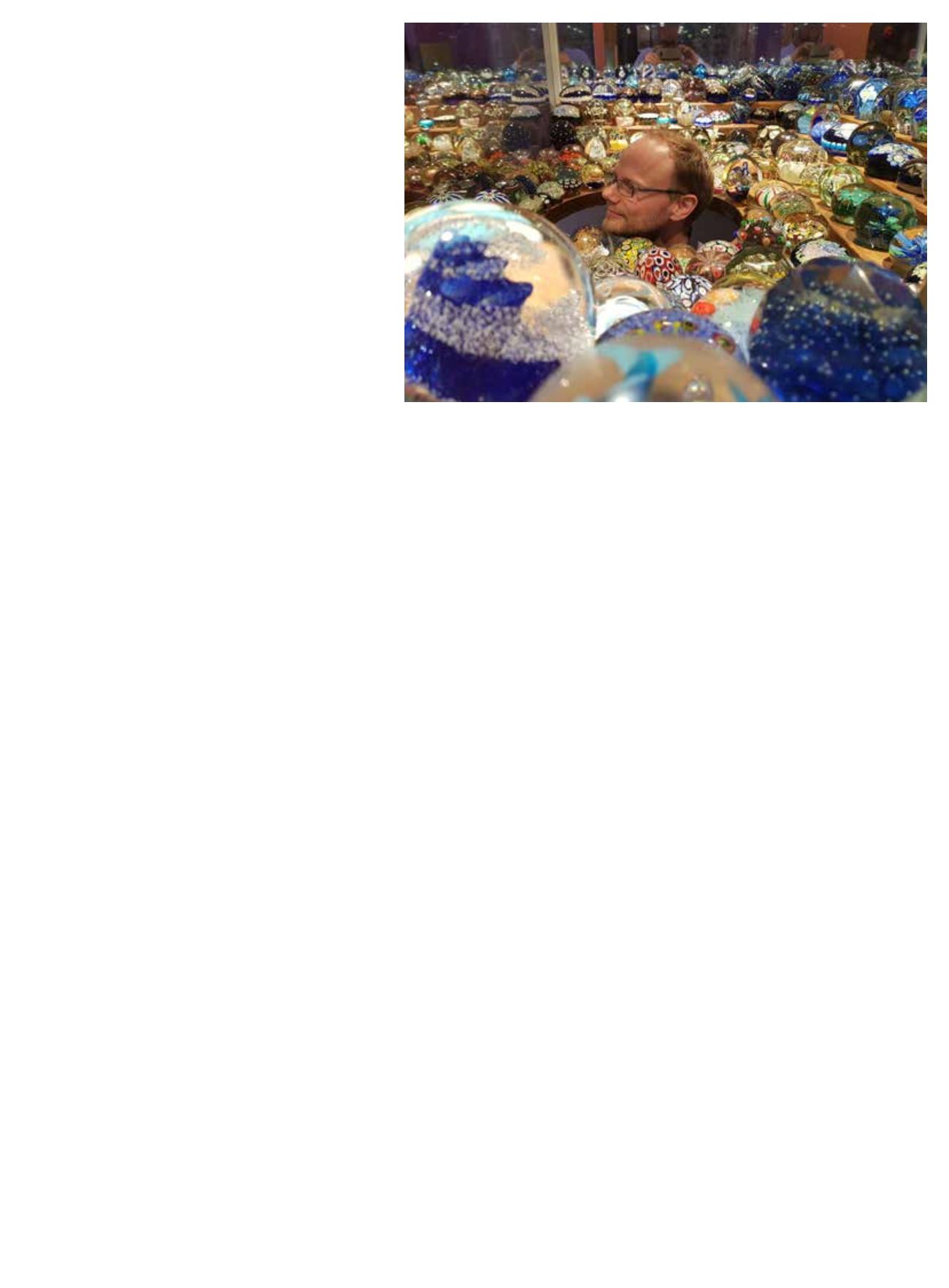
|35 |
aviso 2 | 2018
KUNST = MEDIZIN
COLLOQUIUM
meister von einemGraffiti-Künstler das Bad habe
»verschönern« lassen. Pecher macht keinen Hehl
aus seiner Abneigung gegen »Täter« wie »Bewun-
derer«. Er empfiehlt eine »ordentliche Tracht Prü-
gel« für die »Sprayfinken« und lässt eine gewisse
Bewunderung für den Bürgermeister von Las
Vegas erkennen, der ihnen die Daumen abschnei-
den lassen wollte. Das Fazit des Münchner Autors
lautet: Es gibt viel zu viele »Künstler, die Jahr für
Jahr MillionenWerke produzieren, die keiner will
und niemand braucht.« Das Buch ist natürlich
totaler Shit. Es ist aber immerhin doch so gut, dass
es die Finger auf eine Wunde legt. Pecher steht für
die schweigende Mehrheit. Viele verstehen nicht,
wofür eine Kunst, die den Normen konventioneller
Erbauungsästhetik nicht Genüge leistet, gut sein
soll.
ImBuchheimMuseum lief die Sprayer-Ausstellung
glücklicherweise ohne körperliche Gewaltanwen-
dung ab. Es ist gelungen, Pechers engstirnigem
Ansatz Buchheims Parole »Think big!« entgegenzu-
schleudern. WON ABC war geladen, einige Räume
des Hauses mit Tafelbildern von sich und seinen
Münchner Sprayer-Kollegen zu füllen. Überdies
bekam er den Auftrag für ein großes Wandbild.
Die Festrede zur Einweihung hielt – bei seiner be-
kannten Begeisterung für das Genre keinWunder –
der mittlerweile ehemalige OB mit dem bunten
Badezimmer, Christian Ude. Mit Stiftungsvor-
stand Kurt Faltlhauser zeigte sich aber auch der
ehemalige bayerische Finanzminister amRedner-
pult begeistert über die Arbeit vonWON ABC. Der
Altmeister des Untergrunds, der es in den 1980er
Jahren mit seinen »Wholetrain«-Bemalungen von
S-Bahn-Zügen bis in den Knast gebracht hatte,
erfuhr mit einem Mal die Anerkennung staatli-
cher Exponenten. Der Kunst war wieder einmal
gelungen, was sie am besten kann: Ordnungen zu
dekonstruieren, Werte umzuwerten – ein Unding
in ein Ding zu verwandeln!
Ist ein Kunstwerk nur das, was es ist?
Wofür brauchen wir aber dieses Spiel der Provo-
kation? Die Kunstgeschichte hat sich lange davor
gescheut, die Verständigung mit den Kulturpessi-
misten zu suchen, die hinter jedem künstlerischen
Aufbegehren einen Verrat an einer naturgegebe-
nen Ordnung vermuten. Der Dialog mit anderen
Fachgebieten wurde vermieden, obwohl doch ge-
rade der Blick über den Tellerrand Antworten auf
die Relevanzfrage verspricht. Der amerikanische
Philosoph Nelson Goodman bringt in seinemBuch
Ways of Worldmaking von 1978 (deutsch: Weisen
der Welterzeugung, 1984) einen Glaubenssatz des
Kunstdiskurses des ausgehenden 2. Jahrtausends
auf den Punkt: Ein »Kunstwerk ist das, was es ist«. Kunst ist nach
Goodman eine in sich geschlossene Weltversion, die keine Interferenz
mit anderen Bereichen des Lebens zulässt.
Es macht durchaus Sinn, die Freiheit der Kunst vor den Einflussnah-
men anderer Interessenssphären zu bewahren. Denken wir nur an das
Negativbeispiel einer Kunst im Dienste der Politik. Wir dürfen sie
jedoch auch nicht hermetisch verschließen. Offenheit und Ambigui-
tätstoleranz sind gefragt. Kunst folgt ihren eigenen Regeln, und doch
hängt sie nicht voraussetzungslos und folgenlos im luftleeren Raum.
Kunst hat Ursachen und Wirkungen, die außerhalb ihrer selbst liegen.
Wenn wir denMenschen erklären wollen, wofür Kunst gut ist, müssen
wir sie mit anderen Wissensbereichen kontextualisieren. Vielleicht ist
es aus diesem Betrachtungswinkel eine große Chance, dass jüngst mit
Marion Kiechle keine Geisteswissenschaftlerin, sondern eine Medizi-
nerin das Kulturressort im Freistaat übernommen hat.
Biologie der Kunst
In jüngerer Zeit ist es immer üblicher geworden, Kunst mit der mensch-
lichen Physis in Bezug zu setzen. Noch vor 20 Jahren wäre das an
den geisteswissenschaftlichen Fakultäten als »übelster Biologismus«
beschimpft worden. Heute kommen wir durch derlei interdisziplinäre
Herangehensweisen zu diskussionswürdigen Ergebnissen, die uns
näher an eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn und Zweck von
Kunst führen.
Der Biologiehistoriker Thomas Junker kommt in seinem Buch »Die
Evolution der Phantasie« zu dem Schluss, dass die Erlangung der
Fähigkeit zur Kunst für den Menschen einen evolutionsbiologischen
Selektionsvorteil darstelle. Kunst sei ein höchst effektives Mittel, sich
über Gefühle oder gemeinsame Ziele auszutauschen. Sie erzeuge Soli-
dargemeinschaften, die Überlebensvorteile verschafften.
Der Kunsthistoriker Karl Schawelka bedient sich in seinemAufsatzband
»Kunst, die hängen bleibt« einiger Ergebnisse der Evolutionsbiologie. Er
stellt die These auf, dass Kunst das menschliche Grundbedürfnis nach
© Buchheim Museum der Phantasie / Daniel J. Schreiber
oben
Spielraum für die Kunst – Haus Buchheim im Buchheim Museum.


















