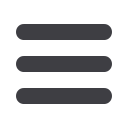

|24|
aviso 2 | 2018
KUNST = MEDIZIN
COLLOQUIUM
und bearbeitet werden kann. Das Selbstvertrauen wächst,
sonst Unsagbares kann ausgedrückt werden und damit seine
krank machende Wirkung verlieren. Was in der bildneri-
schen Arbeit an Ausdauer, Einfühlung, Vertrauen, Einsicht,
Gefühl für Kompetenz, Neugierde, Unternehmungsgeist etc.
entwickelt wird, kann in das Alltagsleben übertragen werden.
UM ZU VERSTEHEN
, wie die Bereiche »Kunst« und »Therapie«
zusammenkommen können, muss man nach dem Kunst-
begriff fragen, der in der Kunsttherapie verwendet wird.
Im klassischen Sinn hat Kunsttherapie wenig mit Kunst zu
tun: Es geht nicht um die Produktion von Kunst. Klienten
und Patienten arbeiten nicht für die Öffentlichkeit, nicht für
Galerien und nicht für den Kunstmarkt.
Im Sinne Beuys´ jedoch, der den Begriff der Kunst um die
kreative Gestaltung des Lebens allgemein erweiterte, ver-
schmelzen diese beiden Begriffe und werden zu einem Pro-
zess. Dann gilt, was Beuys sagt: »Kunst ist ja Therapie.«
IN UNSEREM VERSTÄNDNIS
von Kunsttherapie geht es also
nicht um das fertige Werk, sondern um den gestalterischen
Prozess, der die Sprache der Bilder verwendet. Er reflektiert
und konfrontiert Fragen, Blockaden, Probleme, er spiegelt
das Suchen, die Ressourcen und die Lösungen.
In der künstlerischen Arbeit finden Klienten und Patienten
selbständig oder unter Anleitung durch die begleitenden
Kunsttherapeuten eine Lösung für bildnerische Herausfor-
derungen und Probleme, die den Herausforderungen und
Problemen im Leben entsprechen. Diese Erfolge stärken das
Vertrauen und den Willen generell, Probleme zu lösen und
sich Herausforderungen zu stellen. Nicht die Krankheit und
die damit verbundene, oft festgefahrene Haltung stehen im
therapeutischen Atelier im Vordergrund, sondern die Fähig-
keit, neue Wege und Lösungen zu finden.
OFFENSICHTLICH LIEGT IN
der künstlerisch-bildnerischen
Arbeit selbst ein therapeutisches Element, das die Selbsthei-
lungskräfte fördert. Zum Beispiel konnte beobachtet wer-
den, dass während künstlerischer Projekte in geschlossenen
psychiatrischen Abteilungen die beteiligten Patienten keine
psychotischen Schübe erlitten. Ein hoher Prozentsatz konnte
nach zweimonatiger Projektdauer auf offene Abteilungen
verlegt werden.
Auch Schmerzpatienten, depressiven oder an einer unheilba-
ren Krankheit leidenden Patienten kann mit künstlerischem
Arbeiten geholfen werden. Die intensive Konzentration auf
den gestalterischen Prozess bindet die Aufmerksamkeit an
konstruktives Tun. Damit wird sie dem Leiden und dem
Symptom entzogen. So entsteht ohne Leugnung der Krank-
heit eine neue Ausdrucksweise. Indem Leiden gestaltet wird,
findet es eine kreative Form, wird respektiert und gleichzei-
tig relativiert. Dem bildnerisch Tätigen stellt sich eine pro-
duktive, sinnvolle Aufgabe, die die Opferrolle als Kranker
ersetzt.
Grundlagen der kunsttherapeutischen Arbeit
Worauf lässt sich die verändernde Wirkung des bildneri-
schen Gestaltens zurückführen? Die Beobachtung verschie-
dener künstlerischer Projekte zeigt: Kunsttherapeuten sind
am Form- und Farbgebungsprozess orientiert. Dabei ste-
hen nicht ästhetische Kriterien im Mittelpunkt, sondern
was der Klient oder die Klientin ausdrücken will und kann.
Sie unterstützen diesen Prozess und geben, wenn nötig, die
technischen Anleitungen dazu. In dem Maße, in dem der
formal-ästhetische Aspekt in den Hintergrund rückt, tritt
der persönliche Ausdruck hervor, der dann in der Dialektik
des Prozesses eine authentische Gestaltung findet, die den
Gestaltenden zufriedenstellt.
IN DIESEM PROZESS
drücken sich Geschichte, Prägung und
Struktur des Klienten aus. Diese äußern sich unmittel-
bar und werden vom Gestaltenden direkt verstanden. Das
Unsichtbare wird sichtbar, auch wenn es oft nicht in Worte
gefasst werden kann. ImBild ist eine eigene Form der Trans-
formation möglich. Alles kann sich verwandeln: Gefühltes
Chaos, psychisch noch Ungestaltetes erhält objektivierte,
sichtbare Form, die, losgelöst vom Träger, weiterbearbei-
tet werden kann. Was in anderen Lebensbereichen, z. B. im
sozialen Kontakt, unmöglich erscheint, wird auf dem Papier
möglich. Die gemalten Bilder werden unbewusst gespeichert
und beeinflussen die Gedanken. In diesem, in der Regel
ungeübten, das heißt auch unverbildeten Bereich sammelt
sich plötzlich, was sonst im Leben verdrängt wird und for-
dert zur Auseinandersetzung auf. Oder: Es drängen sich For-
men und Inhalte auf das Papier, von denen der Malende im
Leben überflutet und überschwemmt wird. Auf dem Papier
kann er sie ordnen und »zähmen« und wieder Herr über sie
werden. Die Objektivierung ist mit einer Neutralisierung
verbunden, die neue Aspekte und unerwartete Formgebung
ermöglicht.
Da Form und Inhalt nicht zu trennen sind, verwandelt sich
mit der neuen Form auch der Inhalt. So ist die künstleri-
sche Arbeit an der Form gleichzeitig auch Arbeit am Inhalt
und an sich selbst.
DAMIT DIESER VERWANDLUNGSPROZESS
geschehen kann, ist
eine bestimmte Atmosphäre nötig, die man vielleicht künst-
lerische Atmosphäre nennen könnte. Sie besteht einmal
in der Akzeptanz des jeweiligen Kunsttherapeuten allen
Erscheinungsformen gegenüber, die sich äußern, seinem
intuitiven Verstehen der Bilder, seiner eigenen Bereitschaft,
einmal Geformtes wieder zu verändern, seiner Neugier und
seinem unvoreingenommenen Interesse amGeäußerten. In
diesem Prozess verschwindet die Frage, was Kunst ist, das
unmittelbare Tun steht im Vordergrund und das Bemühen,
die Hindernisse beiseite zu räumen, die einer flexiblen Ent-
faltung von Ideen im Bild im Wege stehen.
rechts
Bildbesprechung.


















