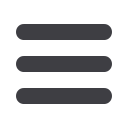
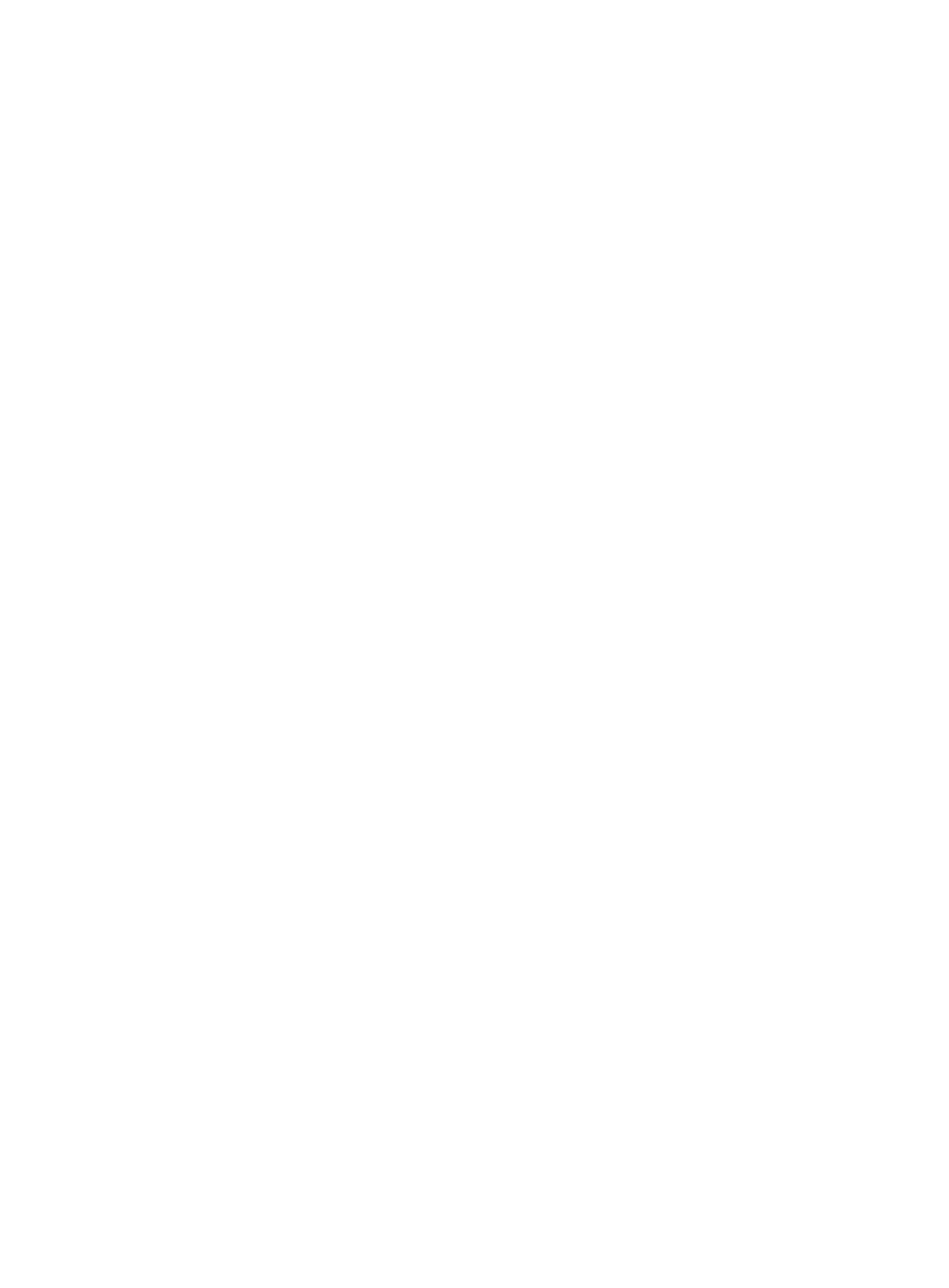
|19 |
aviso 2 | 2018
KUNST = MEDIZIN
COLLOQUIUM
gläschen, Röntgenplatten und sogar medizinische Lehr
bücher in seine Objekte. Es handelt sich umMaterialien, die
symbolhaft auf Verletzung und Heilung, auf Vergänglichkeit
und Verfall anspielen.
BL:
Bereits in Ihrem ersten Buch über Joseph Beuys »Wolle,
Fett und Schwefel: Alte mythische Inhalte werden aktuell«
(Köln, Deutscher Ärzteverlag 1972) haben Sie auf die für
Beuys so wichtige Einheit von Leib und Seele verwiesen, die
auch moderne ganzheitliche Therapie-Ansätze auszeichnet,
aber bei Beuys auf einer fundamentalen Kenntnis der Geis
tesgeschichte beruht.
AHM:
Sucht man nach den Grundprinzipien imBeuysschen
Werk, so reichen seine intellektuellen Wurzeln weit über die
Geschichte der abendländisch-christlichen Religion und
Heilkunde bis in die Prähistorie mit ihrem intuitiven und
atavistischen Verhaltensmustern zurück. Denn vor allem in
den uralten irrationalen und religiösen Weltvorstellungen
wie etwa im Schamanismus, im Animismus, in der Gnostik
oder in der Mystik herrschte ein ganzheitliches Weltkonzept.
Die Trennung von Leib und Seele, die die naturwissenschaft-
liche Medizin mit ihrer Entfaltung seit dem 18. Jahrhun-
dert mit sich gebracht hat, wollte Beuys wieder aufheben. Er
betrachtete sie als nicht hilfreich für die freie Entfaltung
des Menschen.
Schon in seinen figürlichen Zeichnungen der vierziger, fünf-
ziger und sechziger Jahre tritt vor allem ein ausgesprochen
prozesshafter, ganzheitlicher Charakter zu Tage. Häufig sind
Themen wie Geburt, Krankheit und Sterben zu finden. In
ihnen sind deutlich neben evolutionären Fragen spiritu-
elle Elemente des Heilens und Überwindens von Leid und
Schmerz vorhanden. Diese auch auf das eigene Denken des
Betrachters zielende künstlerische Tendenz lässt sich kon-
tinuierlich in allen Phasen seines künstlerischen Schaffens
verfolgen. Wie Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) hat er im
Menschen »das kranke Wesen« gesehen. Allerdings baute
er imGegensatz zu Nietzsche auf der christlichen Heilslehre
mit ihrem zentralen Bekenntnis zu den Werken der Barm-
herzigkeit, zu denen das Beherbergen, Ernähren und Pflegen
zählen, sein vielschichtiges Gedankengebäude auf.
BL:
Als Medizinhistoriker waren Sie Joseph Beuys ein kennt-
nisreicher Gesprächspartner, und als Kunsthistoriker ein
Autor, der die medizinischen Zusammenhänge in seinem
Werk entsprechend fundiert benennen kann. Denn bei aller
Intuition fußte es gleichzeitig auf einer soliden Vertrautheit
mit den Pionieren der Heilkunde, deren Philosophie so man-
chem Objekt zugrunde liegt.
AHM:
Es lag in seinem komplexen künstlerischen Konzept
nahe, dass sich Beuys folgerichtig auch mit der Heilkunde,
die die Menschheitsgeschichte von Anfang an begleitet, mit
ihrem Denken, Fühlen und Handeln, ihrer Moral und ihrer
Ethik beschäftigt hat. Dabei rückten für einen so ganzheit-
lich orientierten Künstler besonders die Außenseiter der
Medizin wie Paracelsus (1493–1541), Franz Anton
Mesmer (1734–1815) mit seiner Psychotherapie
oder Samuel Hahnemann mit seiner Homöopathie
(1755–1815) ins Zentrum seines Interesses. Diese
Ärzte verbanden als Grenzgänger der Schulmedi-
zin in der Regel die naturwissenschaftliche Me-
thodik, die durch das Messen, Wägen und Zählen
charakterisiert ist, mit metaphysischen Ideen und
spirituellen Eingebungen. Sie haben schon andere
Künstler, Dichter und Naturphilosophen seit der
Romantik wie Caspar David Friedrich (1774–1840),
Novalis (1772–1801), Friedrich Wilhelm Schelling
(1775–1854), den Arzt und Maler Carl Gustav Carus
(1789–1869), den Anthroposophen Rudolf Steiner
(1861–1925) und schließlich keinen geringeren als
Sigmund Freud (1856–1939) beeinflusst. Diese
außergewöhnlichen kreativen Persönlichkeiten,
die Leib, Seele und Geist des kranken Men-
schen in ihren philosophischen und therapeu-
tischen Konzepten wollten, standen ihm geistig
nahe.
In zahlreichen Zeichnungen und Aquarellen wie
etwa »Russische Krankenschwester« (1943), »Zwei
bandagierte Frauen« (1949), »Kalb mit Kindern«
(1950), »Mann mit gläsernemKindersarg« (1950),
»Im Haus des Schamanen« (1954), »Lazarus«
(1957), »Der Tod und das Mädchen« (1957) oder
das »Contergankind« (1963) klingt in ihrem sen-
siblen Duktus dieses für den Menschen existen
tielle Spektrum bei Beuys motivisch unüberseh-
bar an. Das Thema menschlicher Verwundbarkeit
und Sterblichkeit hat dann in den sechziger und
siebziger Jahren mit den Beuysschen Plastiken
wie »Injektionsspritze mit Tonklumpen und
Streichholzschachtel auf Tannennadeln« (1963),
»Hasengräber« (1963–1967), »Rückenstütze eines
feingliedrigen Menschen (Hasentyp) aus dem
20. Jahrhundert p. Chr. (1977), »Die Kreuzschmer-
zen der Frau« (1978) oder »Cuprum 0,3% unguen-
tummetallicum praeparatum« (1978) eine weitere
Steigerung erfahren.
In ihnen allen spielen direkt oder indirekt Dia-
gnosen und therapeutische Hinweise eine we-
sentliche Rolle. Schließlich zieht Beuys in seinem
Alterswerk noch einmal in den graphischen Suiten
»Schwurhand« (1980) »Zirkulationszeit« und »Trä-
nen« (1985), in denen er teilweise auf sein früheres
zeichnerisches Oeuvre zurückgreift, eine künstle-
rische Bilanz seiner Sujets und Motive. Es entste-
hen außerdem noch die großen, thematisch mit
der Heilkunde verbundenen Installationen »Zeige
deine Wunde« (1976), »Schmerzraum« (1983) und
»Das Ende des 20. Jahrhunderts« (1984) – glanz-
volle Höhepunkte seiner von Schwermut durchzo-
genen Kunst.


















