
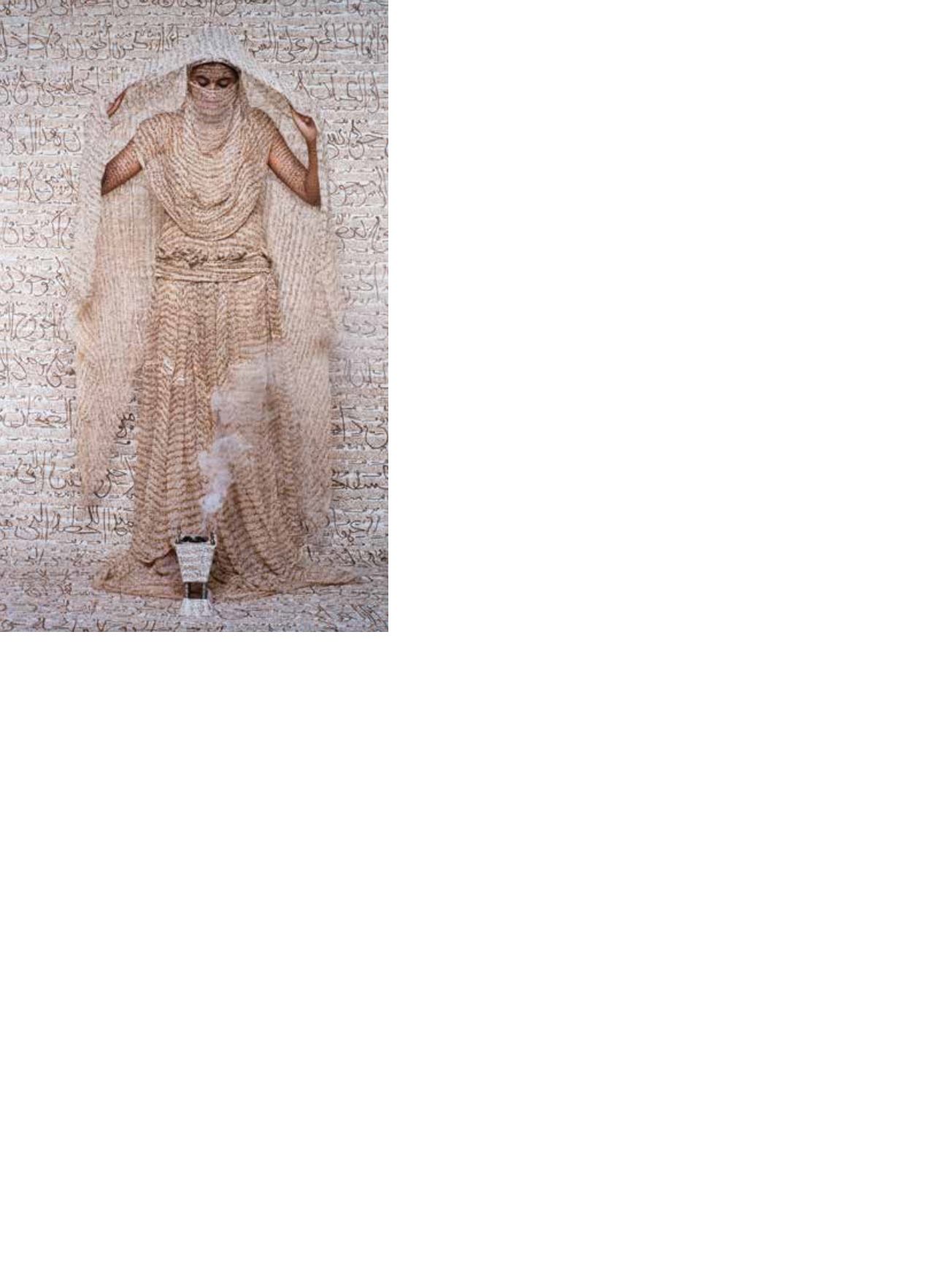
|29 |
aviso 4 | 2017
GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN
COLLOQUIUM
Der Rechts- und Islamwissenschaftler
Professor Dr. Mathias Rohe
ist Ordinarius für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Er war Gründungsdirektor des Erlanger Zentrums für
Islam und Recht in Europa (EZIRE), Mitbegründer, Vorsitzender und bis
heute Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Arabisches und
Islamisches Recht (GAIR). Rohe war Mitglied der ersten und der zweiten
durch das Bundesministerium des Innern initiierten Deutschen
Islamkonferenz (DIK); er ist Mitglied zahlreicher Arbeitsgruppen und
Gesellschaften zum Thema Islam, Islamismus und Islamfeindlich-
keit sowie islamisches Recht.
Zum Weiterlesen
Mathias Rohe, Der Islam in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme,
München 2016 (C.H. Beck)
das imNamen ihrer Religion in anderen Teilen der
Welt oder auch von Extremisten in Europa began-
gen wird. Die Maßstäbe des Rechtsstaats sind ein-
deutig: Er beurteilt Menschen nach ihrem eigenen
Reden und Handeln, nicht nach demHandeln an-
derer oder nach demWortlaut religiöser Schriften.
Der Islam hat wie fast alle religiösen und weltan-
schaulichen Richtungen ein Gewaltpotenzial; es
ist aber ebenso wenig charakteristisch für ihn wie
für andere Religionen.
Zukunftsperspektiven
Was bleibt zu tun? Nach jahrzehntelanger Präsenz
von Muslimen im Land ist es an der Zeit, die im
Alltag schon weitgehend gelebte Normalität des
Zusammenlebens imRahmen des geltenden Rechts
auch institutionell auf ein festes Fundament zu
stellen. Dabei muss die Vielfalt muslimischer Stim-
men undHaltungen angemessen beachtet werden.
Manche schließen sich religiösen Organisationen
an, die z. B. Moscheen unterhalten, andere wirken
in Beruf und Freizeit in säkularen Kontexten. Mit
allen kann und muss im jeweils geltenden sach-
lichen Zusammenhang und rechtlichen Rahmen
gesprochen werden. Wichtige Schritte sind etwa
die Einrichtung einer authentischen, hiesigen pädagogischen und didak-
tischen Maßstäben entsprechenden religiösen Bildung in öffentlichen
Schulen. Hier hat Bayern seit 2003 eine Vorreiterrolle übernommen.
Parallel dazu wurde die universitäre Ausbildung muslimischer Lehr-
kräfte und seit 2012 auch die Etablierung der islamischen Theologie im
universitären Rahmen (in Bayern an der FAUErlangen-Nürnberg) in die
Wege geleitet. Bei dieser Etablierung eines neuen Fachs auf wissenschaft-
licher und institutioneller Augenhöhe mit anderen Theologien stellen sich
einige Herausforderungen. Es müssen im Grunde die Aufgaben einer
Fakultät erfüllt werden, ohne auch nur annähernd über die Kapazitäten
einer auch kleinen Fakultät zu verfügen. Mittelfristig wird es deshalb
darauf ankommen, die bestehenden Standorte zu konsolidieren. Das
kann nur gelingen, wenn zugleich islambezogene andereWissenschaften
am Standort unterstützend mitwirken, wie dies an der FAU der Fall ist.
Die muslimischen Organisationen wandeln sich zusehends von zunächst
stark ethnisch geprägten Vereinigungen zu inländischen Religions
organisationen. Wichtig, aber nicht zu erzwingen, ist der Prozess,
zunehmend die deutsche Sprache zu verwenden und im Inland ausge-
bildete Kräfte zu beschäftigen. Bei alledem sind die vielen in aller Regel
ehrenamtlich Arbeitenden häufig an den Grenzen der Belastbarkeit. Die
wünschenswerte inländische Finanzierung ist noch weitgehend unge-
löst, Kooperationen haben meist noch Modellcharakter. Noch fehlt es
häufig an theologischer Expertise, um dem Extremismus entgegenzu-
treten; zudem zeigen sich Ängste, sich auf Gespräche mit Extremisten
einzulassen, wenn die Gefahr besteht, selbst in Extremismusverdacht
zu geraten. Auch in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungsein-
richtungen bis hin zu Krankenhäusern, Altersheimen oder Haftanstal-
ten und Friedhöfen werden unterschiedlichste muslimische Anliegen
sichtbar und bedürfen einer adäquaten Berücksichtigung im Rahmen
der rechtsstaatlichen Ordnung und mit einigem Pragmatismus. Wie
etwa kann man das Fasten von Schülern im Ramadan in Sommermo-
naten so handhaben, dass einerseits das religiöse und soziale Anliegen
ernstgenommen wird, der schulische Erfolg und der Schulbetrieb aber
nicht unzuträglich belastet werden?
Es gilt nach alledem auszuloten, wie sich eine gedeihliche Zusammen-
arbeit auf kommunaler und Landesebene zum Nutzen nicht nur der
Muslime, sondern auch der Gesamtbevölkerung weiter entwickeln lässt.
Die bayerische Akademie der Wissenschaften hat das Erlanger Zentrum
für Islam und Recht in Europa (EZIRE) an der FAU mit einer Studie
beauftragt, die sich in einemSchwerpunkt solchen Fragen widmet. Der
Verfasser hat Anlass zu Optimismus: Bei allen nicht zu übersehenden
Problemen gelingt schon vieles, und vor allem zeigt sich ein verbreiteter
guter Wille auf allen Seiten, diese Probleme anzugehen. In Berlin würde
man sie gerne gegen die dort bestehenden eintauschen.
© picture alliance / SZ/dpa | Museum Fünf Kontinente


















