
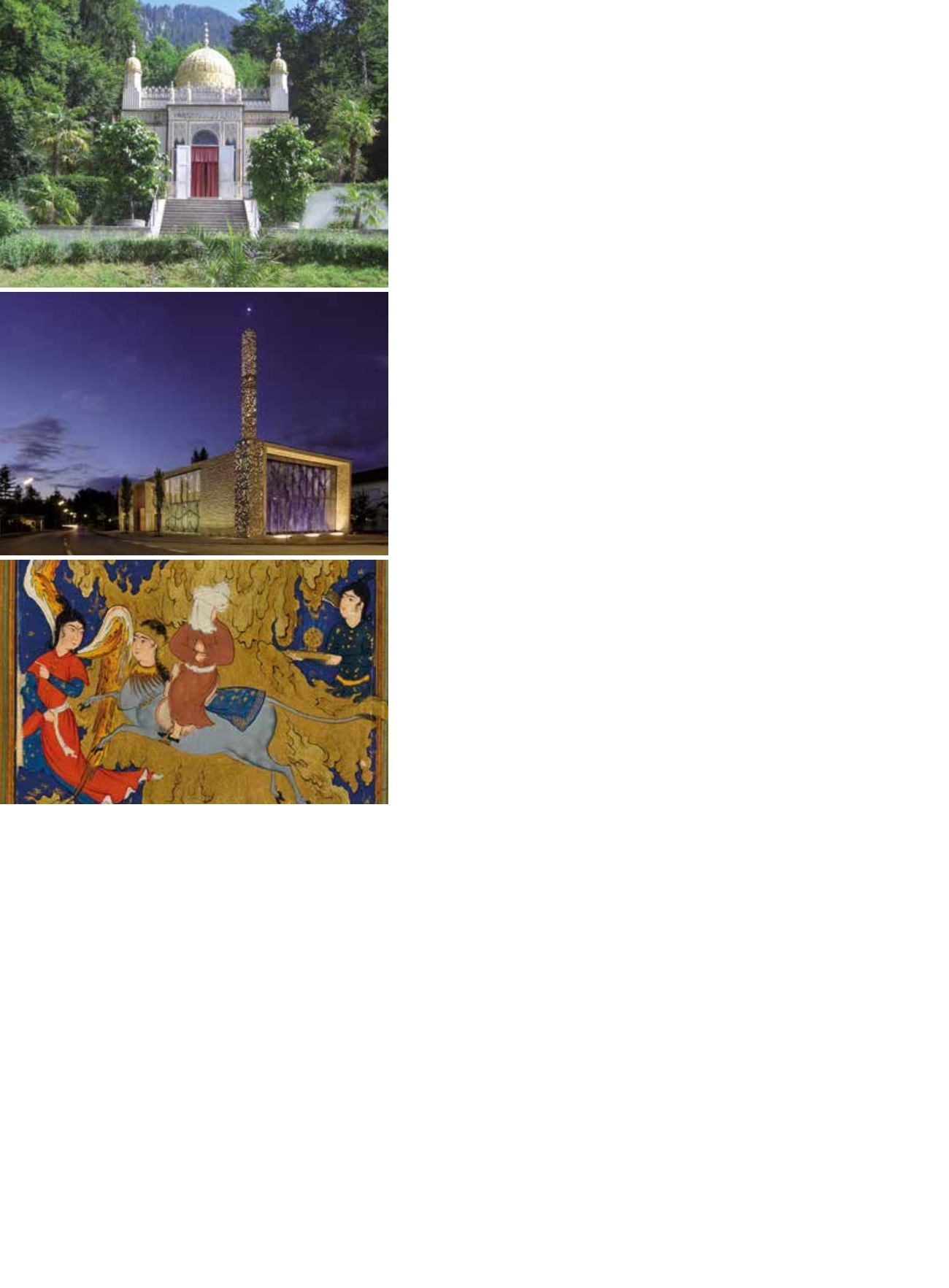
|25 |
aviso 4 | 2017
GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN
COLLOQUIUM
linke Seite
Besuch einer katholischen Kirche mit Erklärung
des Weihnachtsfestes und der Krippe im Rahmen
einer interreligiösen Begegnung junger Menschen in
München 2006.
oben
Der Maurische Kiosk wurde für die Weltausstellung in
Paris 1867 geschaffen. König Ludwig II. kaufte ihn im
Jahre 1876 und ließ ihn prächtig ausstatten. Hier las er und
trank Tee, während orientalisch gekleidete Diener
Wasserpfeife rauchend einen lebenden Hintergrund
bildeten.
darunter
Das Islamische Forum in Penzberg: Hier ließ sich
eine kleine islamische Gemeinde ein Forum mit
Gebetsraum in zeitgenössischer Architektur bauen – ein
couragiertes Unterfangen, dem der Wunsch
nach Integration zugrunde liegt.
darunter
Eine Handschrift der BSB zeigt die Schatzkam-
mer der Geheimnisse, Qazvin, 1579, persisch. Nächtliche
Himmelfahrt Mohammeds Cod.pers. 382, Blatt 10v.
Die Geschichte des Islam hierzulande ist älter als die der Muslime. Im
Süden und Osten Europas lebten seit demMittelalter erhebliche Zahlen
von Muslimen. Neben kriegerischen Auseinandersetzungen fand dort
auch ein reicher kultureller Austausch statt. Hierzulande nahmman den
Islam dagegen weitestgehend aus der Distanz wahr, ohne Begegnung
mit seinen Anhängern. Im Rahmen der Kreuzzüge und später aus den
Kriegenmit demOsmanischen Reich gelangte dannmehr Information
zu uns. DemMünchener Johannes Schiltberger, der 1396 als 16jähriger
Knappe eines bayerischen Ritters in osmanische Gefangenschaft geriet
und dort 31 Jahre verbleiben musste, verdanken wir einen ersten fak-
tenreichen Bericht eines Deutschen (»Als Sklave imOsmanischen Reich
und bei den Tataren«). Informativ ist auch die »Reysbeschreibung eines
Gefangenen Christen Anno 1604« des Nürnbergers Johann Wild, der
als 19jähriger kaiserlicher Soldat in osmanische Hände fiel, sieben Mal
als Sklave verkauft wurde und unter anderem Mekka besuchte. Zum
ersten Mal wurde er übrigens als gefangener kaiserlicher Soldat von
einem gegnerischen calvinistischenMagnaten in Ungarn an einen Türken
verkauft.
Ein reicher Kulturaustausch
Der reiche Kulturtransfer aus der islamisch geprägten Welt seit dem
Hochmittelalter hat sich in Deutschland in der Übernahme zahlreicher
arabischer, persischer und türkischer Fremdwörter ins Deutsche nie-
dergeschlagen – von Algebra bis Zenit. Als Beispiel für Wissenstransfer
bewahrt die Bayerische Staatsbibliothek inMünchen das Vorlesungsma-
nuskript einer Würzburger medizinischen Handschrift aus dem Jahre
1347 auf, in welchemder dortigeMagister und Stiftsherr auf Erkenntnis-
se des großen zentralasiatisch-iranischen Gelehrten Ibn Sina (Avicenna;
gestorben 1037) aus dem 11. Jahrhundert aufbaut. Dieser Gelehrte wurde
in Europa für seine medizinischen ebenso wie für seine philosophischen
Werke berühmt, in welchen er Glauben, Mystik und wissenschaftliches
Denken zu einen suchte. Die Bayerische Staatsbibliothek beherbergt
heute eine seit dem 16. Jahrhundert angelegte Sammlung orientalischer
Manuskripte mit Weltgeltung.
Von »Türkengefahr« und »Beutetürken«
Dennoch dominierte lange Zeit eine fundamental ablehnende Sicht
gegenüber der islamisch geprägten Welt. Die »Türkengefahr« war
im 16. und 17. Jahrhundert ja auch durchaus real. Die in Nürnberg
gedruckte Schedel’sche Weltchronik von 1493, eines der bedeutends-
ten Druckwerke der frühen Neuzeit, wurde in einer Buchhändler
anzeige unter anderem mit folgenden Versen beworben, welche auf
die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen unter Sultan
Mehmet II im Jahre 1453 anspielt: »Was der Türke, der wild die
weite Erde durchreitet, Konstantinopel Grässliches angetan, Überlie-
ferst Du uns ebenfalls wie die himmlischen schrecklichen Zeiten, Die
Kometen, undmanch gräulicheMissgestalt.« In Städten wie Burghausen,
Regensburg und Nürnberg wurden im 16. und 17. Jahrhundert die Stadt-
mauern aus Furcht vor dem osmanischen Heer verstärkt. Später wen-
dete sich das Kriegsglück gegen die Osmanen. Im Augsburger Dom
hängt bis heute eine imposante Fahne des osmanischen Heeres, die der
Markgraf Ludwig von Baden (»Türkenlouis«) 1689 in der Schlacht von
Nissa erbeutet hatte. Noch 1843 wurden für das Markgrafendenkmal
auf dem Erlanger Schlossplatz erbeutete osmanische Kanonen umge-
schmolzen.
© picture alliance/Sueddeutsche Zeitung | Bayerische Schlösserverwaltung
www.schloesser.bayern.de, Foto: Veronika Freudling | Islamische Gemeinde Penzberg e.V. (IGP) | BSB


















