
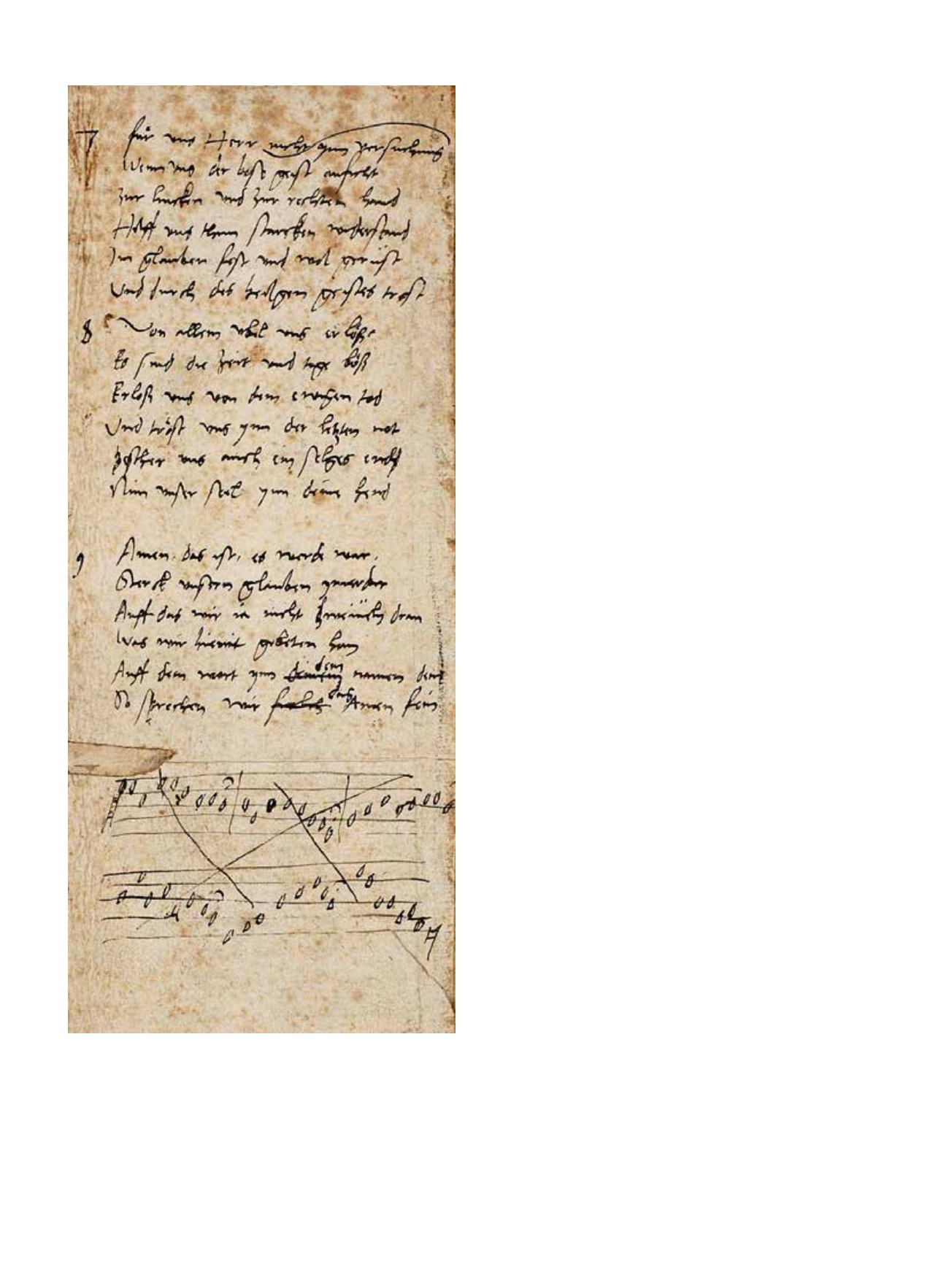
|23 |
aviso 4 | 2017
GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN
COLLOQUIUM
Professor Dr. Ulrich Konrad
ist seit 1996 Ordinarius für
Musikwissenschaft an der Universität Würzburg. Als erster
und bislang einziger Musikwissenschaftler wurde er 2001
mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ausgezeichnet. Er ist Ordentliches Mitglied der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften.
verstandene Wirken des Geistes wiederum zielt auf die Ver-
lebendigung des geoffenbarten und in der Schrift bezeugten
Gottesworts. In der Fastenpostille von 1525 bringt Luther
dies auf die lapidare Formel: »Gottes Wort will gepredigt
und gesungen sein«. Musik dient demnach der im Klang
sinnlich erfahrbar werdenden Verkündigung des Wortes,
wird zur praedicatio sonora.
Ein dritter Grundstein: Richtet sich die Musik in erster
Linie von deren Schöpfer über den Menschen wieder an den
Schöpfer zurück, so wirkt sie imWeiteren auch imMenschen
für den Menschen. In ihr drückt er sich selbst aus und wird
durch sie beeindruckt, sie ist »aller bewegung des Menschli-
chen hertzens […] eine Regiererin«. Luther verweist in die-
sem Zusammenhang stets am Beispiel von Davids Harfen-
spiel auf ihre positive therapeutische Wirkung bei Trauer und
Niedergeschlagenheit. Diese Wirkung lässt sich im Begriff
einer »recreatio cordis« zusammenfassen, in einer, wört-
lich übersetzt, Wiedererschaffung des Herzens. Gemeint ist
damit, dass der Mensch beimHören vonMusik und der in ihr
zahlhaft repräsentierten vollkommenen Ordnung der Schöp-
fung in seinem Innern gleichsam mit der perfekten Schöp-
fungsharmonie synchronisiert und damit in seinen göttlich
intendierten harmonischen Schöpfungszustand zurückver-
setzt wird, einen Schöpfungszustand, den der Mensch selbst
durch eigenes Verfehlen – bei Luther durch das Wirken des
Teufels – permanent stört. Musik eröffnet dem Menschen
auf diese Weise eine Ahnung seines künftigen Seins bei Gott,
im drastischen Originalton Luthers ausgedrückt: »So unser
Her Gott in diesem Leben – in das scheisshauss – solche edle
gaben gegeben hat, was wirdt in jhenem ewigen leben gesche-
hen, wo alle vollkommen und sehr fröhlich sein werden?«
Donum Dei, Laudatio Dei, Praedicatio, Recreatio cordis –
die mit diesen Stichworten bezeichneten Grundsteine des
lutherischen Musikverständnisses, eines durch und durch
christlich-theologisch fundierten Verständnisses, behielten
ihre Gültigkeit so lange, wie die mit ihr a priori verbundene
Gottesbezüglichkeit der Musik geglaubt und anerkannt wurde.
Solange christliches Bekenntnis mit seinem absolutenWahr-
heitsanspruch unangefochten galt, wurde an dieser Basis
nicht gerüttelt, blieb der hohe Rang der Musik unbestritten,
was in den ersten nachreformatorischen Jahrhunderten eine
höchst fruchtbare Pflege gottesdienstlicher Musik nach sich
zog. Für die Musikgeschichte im Gebiet des Heiligen Römi-
schen Reichs Deutscher Nation bedeutete dies ein produktives
Nebeneinander von katholischer und evangelischer musica
sacra, und aus dieser durchaus miteinander konkurrieren-
den Doppelheit der Musikkulturen ergab sich der beinahe
unüberschaubare Reichtum an lateinisch- und deutschspra-
chigen Kompositionen für gottesdienstliche Zwecke.
oben
Martin Luther, Vater unser im Himmelreich, eigenhändige Nieder-
schrift, zwischen 1538 und 1539, ein Blatt. Staatsbibliothek zu
Berlin Preußischer Kulturbesitz. – Hier Rückseite mit den Strophen 7-9,
der Neufassung von Strophe 6 sowie einem Melodieentwurf,
dem einzigen bekannten Notenmanuskript Luthers. Die eigene Skizze
verwarf der Reformator und griff für den Druck auf eine fremde Weise
aus dem Gesangbuch der Böhmischen Brüder zurück.


















