
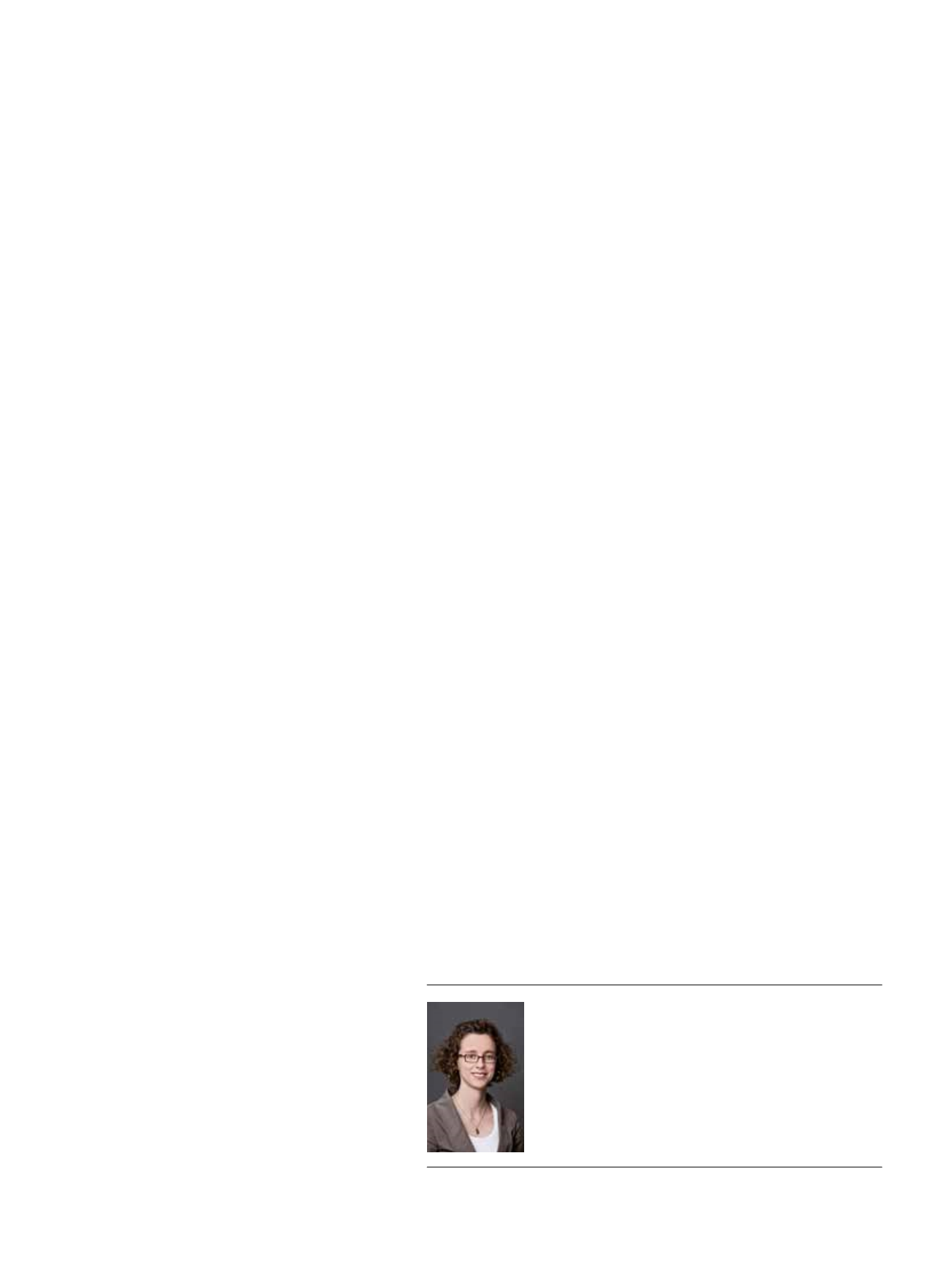
|48|
aviso 4 | 2017
GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN
RESULTATE
RETTERATH
Warum beschäftigen Sie sich mit
Geschichte? Was fasziniert Sie daran?
SCHÖNHÄRL
Das Faszinierende an Geschichte
ist, dass man einWerkzeug in die Hand bekommt,
um Gegenwart zu erklären. Narrative, die bis in
die Vergangenheit zurückreichen, spielen hierbei
eine große Rolle. Geschichtswissenschaft ist schon
als eine Art »Psychotherapie der Gesellschaft«
bezeichnet worden. Da ist viel dran. Eine Aufgabe
des Historikers ist es, Narrative zu entwickeln,
mit denen die Gesellschaft sich ihrer selbst
vergewissern, sich selbst hinterfragen und ihre
Richtung kontrollieren, aber auch gut weiterleben
kann. Das Erklären von Zusammenhängen und
das Eintauchen in ganz fremde, unbekannte
Welten finde ich sehr spannend. Hinzu kommt
die Entdeckerfreude, die manchmal etwas von der
Arbeit eines Detektivs hat. Das ist es, was mich
fasziniert.
RETTERATH
Die Karrierewege in der Wissenschaft
sind häufig steinig und verschlungen. Warum
haben Sie sich dennoch gegen die Schule und für
die Universität entschieden?
SCHÖNHÄRL
Forschung und Lehre machen mir
Spaß. Die Universität bietet die Möglichkeit, beides
miteinander zu verbinden. An der Schule – ich
habe Geschichte und Germanistik auf Lehramt
studiert und das Referendariat gemacht – wer-
den viele Themen leider meist eher oberflächlich
behandelt, und es muss immer wieder das Glei-
che gelehrt werden. Wenn man als Lehrer nur ein
paar Monate hat, um die gesamte Antike vom al-
ten Ägypten bis zum Beginn des Frühmittelal-
ters abzuhandeln, ist der Zeitdruck groß und die
Möglichkeit, einzelne Aspekte zu vertiefen, gering.
Natürlich kann auch der Überblick Spaß machen
und bereichernd sein. In den Fokus muss man
dann wirklich die Arbeit mit den Schülerinnen
und Schülern stellen, nicht die Inhalte.
Dagegen empfinde ich die Möglichkeit an der Uni,
eigene Forschungsinteressen mit der Lehre zu
verbinden, als eine große Bereicherung, zumal ich
sehr gerne lehre. Die Tiefe, in der man die Sachen
behandeln kann, ist einfach eine ganz andere.
Zudem ist es schön, die eigenen Interessen so stark
und autonom verfolgen zu können.
RETTERATH
Trotz jahrelanger Diskussionen,
Appelle undAnstrengungen ist in der akademischen
Geschichtswissenschaft noch immer kein Ge
schlechterproporz erreicht. Woran liegt das Ihrer
Ansicht nach?
SCHÖNHÄRL
Ich kenne viele Kolleginnen, die sich
entschieden haben, aus der Wissenschaft auszustei-
gen, vor allem dann, wenn sie Kinder haben. Lei-
der gibt es immer noch strukturelle Probleme, die
die Vereinbarkeit von Familie und akademischer
Karriere erschweren. Ein Aspekt ist die hohe zeit-
liche und räumliche Flexibilität, die von jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern gefordert wird. Wir sind im vergangenen Som-
mer mit der ganzen Familie für ein Jahr von Essen nach München ge-
zogen und imHerbst, wenn das Stipendium beendet ist, geht es weiter
nach Frankfurt. Der organisatorische Aufwand mit Wohnungssuche,
Bewerbung umKindergartenplätze und so weiter ist immens, und man
fragt sich immer wieder, ob man das den Kindern und dem Partner
zumuten kann. Hinzu kommt als weiterer Aspekt die ökonomische
Unsicherheit einer wissenschaftlichen Laufbahn. Diese lässt sich mit
Familie nicht unbedingt leichter aushalten. Und man muss sich klar
darüber sein: Der Weg in die Wissenschaft mit Familie geht mit Ein-
schränkungen einher. Man muss sich damit abfinden, dass man für
einige Jahre nichts macht außer der Arbeit und den Kindern. Das ist
beides sehr beglückend und bereichernd, aber Zeit für den Partner,
Freunde, ausreichenden Schlaf oder gar Hobbys gibt es daneben kaum.
In der »Rush Hour« einer akademischen Karriere Teilzeit zu arbeiten,
ist nicht möglich. Auf die Dauer ist das sehr anstrengend, weil wenig
Raum für Regeneration bleibt.
RETTERATH
Wie stark ist in der akademischen Welt das Verständnis
für solche Probleme ausgeprägt?
SCHÖNHÄRL
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer
wieder auf Kolleginnen und Kollegen trifft, die einen unterstützen
und bemüht sind, einem mit viel Verständnis weiterzuhelfen. Ganz
viel hängt imMoment noch davon ab, wie die Familie Abwesenheiten
auffangen kann – und solche werden bei Mamas immer noch sehr viel
kritischer beäugt als bei Papas. Welcher Papa wird schon auf Konferenzen
gefragt: »Und, wer kümmert sich jetzt um deine Kinder?« Die Idee,
jungenWissenschaftlerinnen undWissenschaftlern mit Familie weniger
räumliche Flexibilität abzuverlangen, ist sicherlich gut, lässt sich aber nur
sehr schwer umsetzen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft versucht
das, indem sie sagt: Bei Eltern wird die Auslandserfahrung nicht ganz so
stark gewichtet. Aber ich bin skeptisch, ob das in der Praxis tatsächlich
so gehandhabt wird. Mancherorts muss sich die Mentalität schon noch
wandeln. Ich bin vor Kurzem in die engere Auswahl für eine Stelle am
anderen Ende der Republik gekommen – unter der Bedingung, dass ich
in vier Wochen anfange. »Wenn Sie dann nicht da sind, können wir Sie
leider nicht nehmen«, wurde mir gesagt. Das ist aus meiner Sicht ein
Unding. So flexibel kann man einfach nicht sein, wenn man Kinder hat.
Zuweilen trifft man auch auf Kolleginnen und Kollegen, die sich selbst
ganz bewusst gegen die Gründung einer Familie entschieden oder den
Zeitpunkt dafür verpasst haben. Ihnen gegenüber ist es manchmal sehr
schwierig zu vermitteln, dass man selbst gerne Familie und Karriere
verbinden möchte. Manche betonen schon, dass es für Eltern keine
Ausnahmeregelungen gibt – bevor man selbst überhaupt darüber
nachgedacht hat, um solche zu bitten. Zum Glück ist das eher die
Ausnahme.
Dr. Korinna Schönhärl
, geboren 1977, studierte Ge-
schichte und Germanistik an den Universitäten Regens-
burg und Thessaloniki; Referendariat für
das Lehramt an Gymnasien; 2008 Promotion an der
Goethe-Universität Frankfurt am Main über die
Ökonomen im Stefan George-Kreis; seit 2009 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte der Universität Duisburg-
Essen; Forschungsaufenthalte in London, Paris
und Athen. Das Stipendium am Historischen Kolleg
wird vom Historischen Seminar der LMU und
dem Freundeskreis des Historischen Kollegs finanziert.


















