
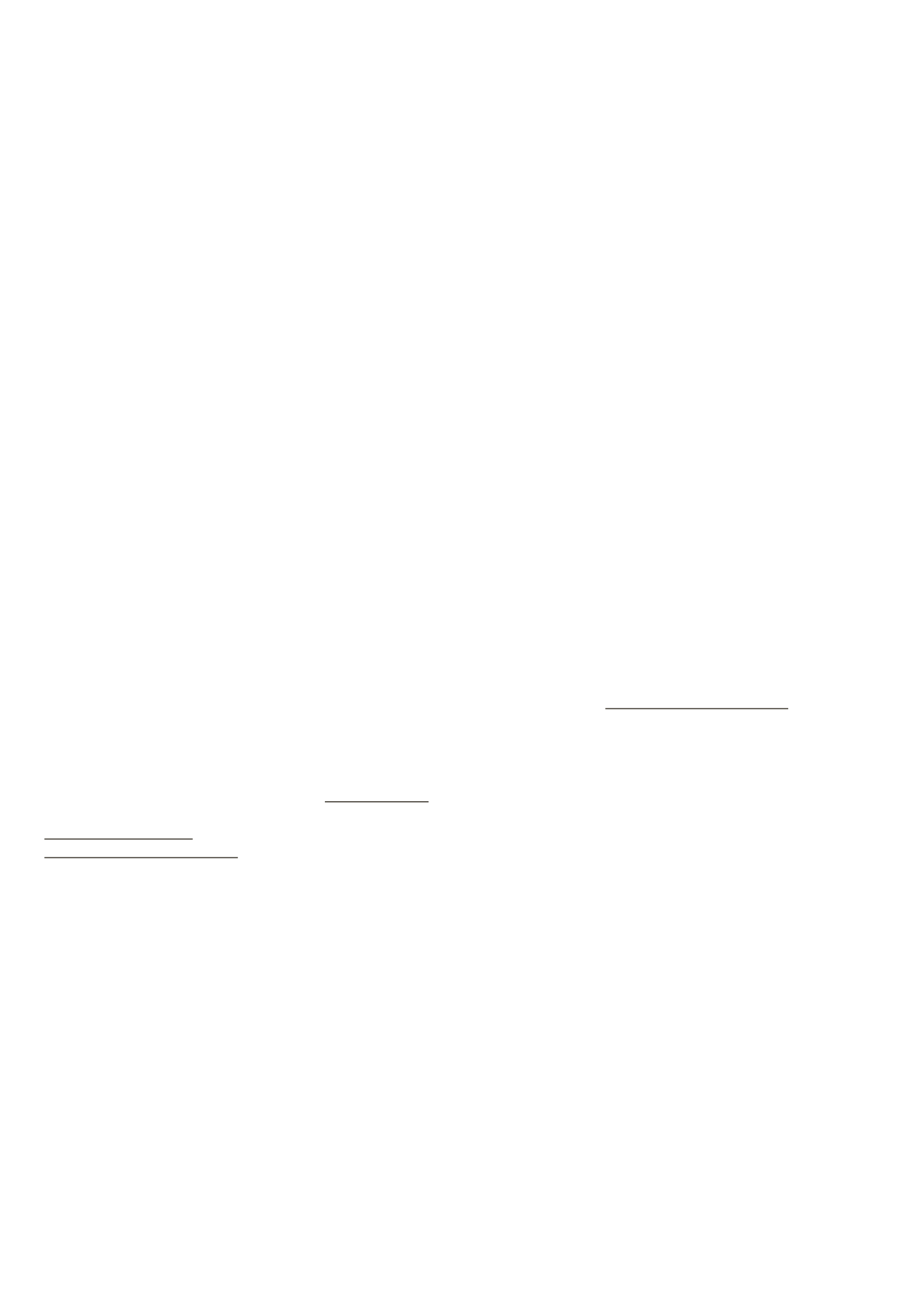
22
st gutes Leben auf dem Land heute
reine Mode und Sehnsuchtsphäno-
men? Ist es mehr oder minder ein Privat-
vergnügen für gut situierte Neu-Eliten
der gehobenen Mittelschicht und des
eigentlich in der Stadt beheimateten sog.
expeditiven Milieus – Menschen, die
nach neuen Grenzen suchen und dabei
das Leben auf dem Land als Herausfor-
derung für sich entdecken? Finden sie auf
dem Land – und je peripherer und abge-
legener, desto besser – ihren Raum zur
Selbstverwirklichung? Mit vergleichs-
weise wenig Geld lässt sich dieses gute
Leben auf dem Land recht einfach eta-
blieren –mit aufgepeppten und sanierten
Häusern und viel Platz; also allem, was
in den heutigen Metropolen immer we-
niger möglich ist. Und im Zweifel kann
man sich ja immer noch eine kleine Zweit-
wohnung in der Stadt nehmen.
Kontrastprogramm zur
Flüchtigkeit unseres Lebens?
Das gute Leben auf dem Land: Es ist die
Sehnsucht nach entschleunigender Na-
turnähe, Verlässlichkeit, praktisch-hand-
werklichem Tun (iKleinbäuerlichkeitl)
und dem Zusammenhalt einer lokal ge-
bundenen Gemeinschaft – Werte, die
im 21. Jahrhundert durch die Flüchtig-
keit und Schnelligkeit der Digitalisierung
scheinbar zu verschwinden drohen. So
scheint sich etwa die Vorstellung prak-
tisch-handwerklicher Arbeit als struktu-
relles Merkmal von Ländlichkeit umso
stärker in unsere Vorstellungswelt einzu-
brennen, je vehementer eine sich selbst
beschleunigende und urbanisierte Wis-
sensgesellschaft um sich greift, in der das
Jonglierenmit Symbolen amEnde des Ta-
ges dann doch kein griffiges und greiwares
Ergebnis produziert. Wie sehr beruhigt
dann die amHorizont erscheinende Aus-
sicht, dass es im Ländlichen ganz anders
zugeht. Würde man doch nur auf dem
Land wohnen können und im eigenen
Nutzgarten all das kompensieren, was das
Leben in der Stadt geschluckt hat. Es ist
ein Blick, der aus der Stadt aufs Land ge-
richtet ist und davon ausgeht, dass Stadt
und Land fundamental unterschiedlich
sind. Zugleich, und so nüchternmussman
das wohl sehen, ist genau diese Sehnsucht
nach dem guten Landleben eigentlich
›nur‹ eine, aber effektive Kopfgeburt. Sie
stellt eine Raumsemantik dar, die des-
halb gut funktioniert, weil sie es mühelos
schafft, viele Aspekte der Wirklichkeit
ländlicher Regionen unerörtert zu lassen.
Ausblendungen
Aber was wird in dieser Raumsemantik
eigentlich ausgeblendet? Natürlich die
Landwirtschaft, die sich als globalisiertes
und industrielles Agrobusiness entpuppt.
Ländliche Gebiete sind kaumnoch klein-
bäuerlich strukturiert, weil diese Struk-
turen aufgrund fehlender Skaleneffekte
nicht auf dem Weltmarkt konkurrieren
und somit überleben können. Der Baye-
rische Agrarbericht von 2018 zeigt das:
So ist die Zahl der Betriebe mit kleinen
Flächen insgesamt rückläufig, während
die größten Betriebe wachsen; das passt
so gar nicht zur Vorstellung vom guten
Leben auf demLandmit kleinbäuerlicher
Landwirtschaft. Die so oft gepriesene
Digitalisierung sorgt dafür, dass selbst
in der Landwirtschaft die Bedeutung des
Arbeitens mit der Hand arg reduziert er-
scheint –mit mehrfachenGPS-Systemen
ausgerüstete Traktoren machen die steu-
ernde Hand des Menschen überflüssig,
erfordern aber technologische Kompe-
tenz. Und was auch ausgeblendet wird,
ist das ieigentlichel Leben für die orts-
ansässigen Menschen, die in peripheren
Regionen leben und dort ihre Wurzeln
und Heimat haben, die dort verankert
und gebunden sind. Es sind Menschen,
die – aber wie sollte es auch anders sein?
– grundsätzlich ähnliche Herausforde-
rungenwieMenschen in Städten zumeis-
tern haben und die oft alles andere als eine
harmonische soziale Einheit bilden.
Probleme ländlicher Räume
Dieses ieigentlichel Leben auf demLand
ist also nur in den seltensten Fällen kon-
gruent mit jenem guten Leben auf dem
Land, das gerade eine Renaissance als
Sehnsuchtsort erfährt. Insbesondere pe-
riphere Orte sind überproportional von
Schrumpfung und daraus resultieren-
den Nahversorgungs- und Mobilitäts-
problemen gekennzeichnet. Im letzten
Raumordnungsbericht konnte man le-
sen, dass mehr als die Hälfte aller Dör-
fer und Kleinstädte in Ostdeutschland
zwischen 2005 und 2015 um mehr als
10% geschrumpft sind. Vor allem junge
Menschen verlassen im Zuge einer Bil-
dungswanderung die Dörfer, in denen sie
aufgewachsen sind; zumeist in die Zent-
ren und Agglomerationen zu Ausbildung
und Studium. Das ist, bei der aktuellen
Wertschätzung akademischer Karrieren,
verständlich, hilft aber den betroffenen
Gemeinden nicht direkt. Umso wichtiger
ist es, Beziehungen zu den Wandernden
aufrecht zu halten und Anreize für ihre
Rückkehr zu geben. Gute Beispiele mit
I
Thema LandLeben
















