
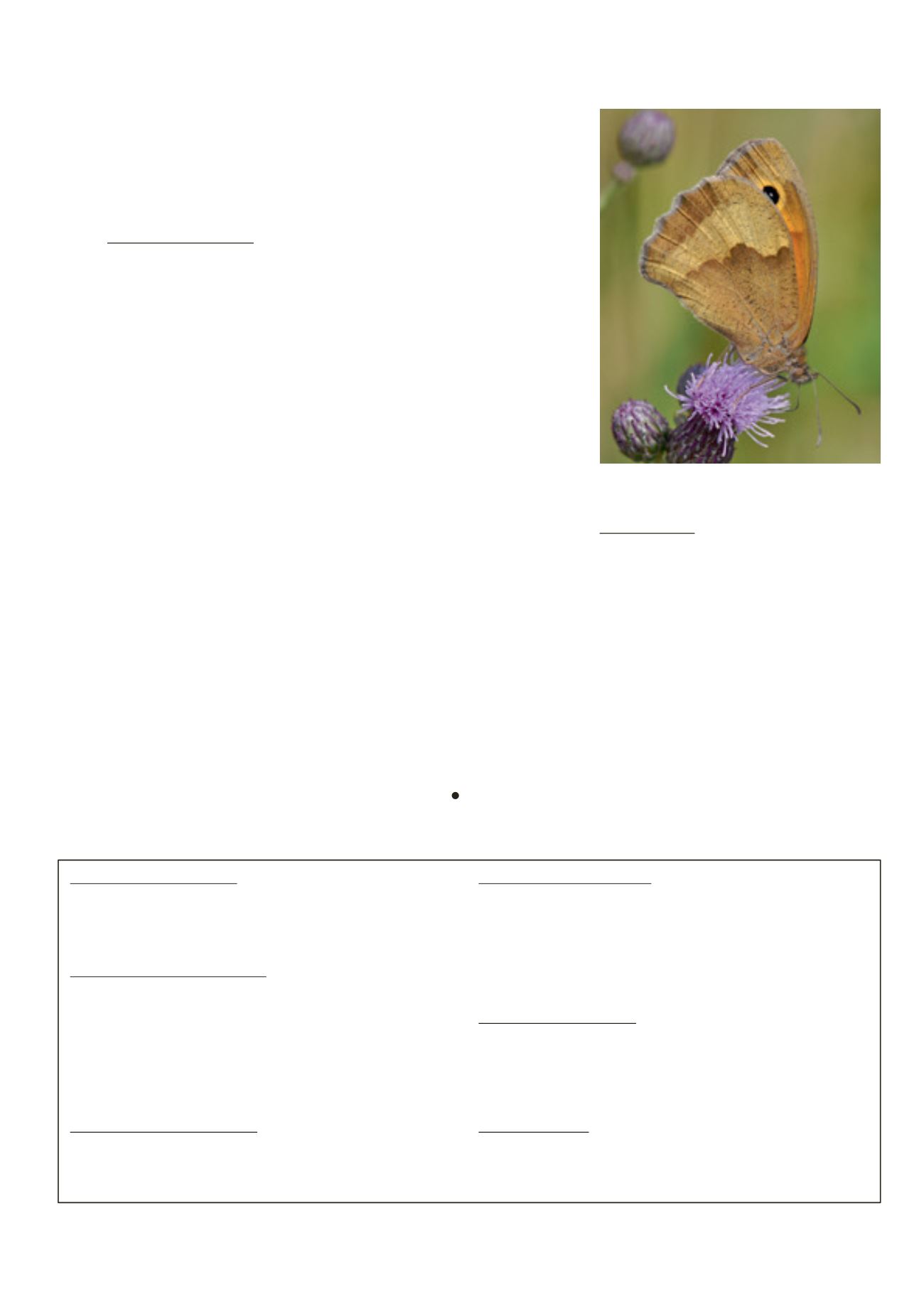
19
Bald ist der stumme Frühling da
Menschen undMedienmit beimgrößten gemeinsamen
Forschungsabenteuer ever!
Netter »Nebeneffekt« emotionalisierter Artenfor-
schungserfolge: Retten wir die Artenvielfalt, retten
wir automatisch auch das Klima und die Zivilisation.
Hört auf die Forscher!
Das große Insektensterben ist ein globales Phänomen.
Inzwischen durch rund 80 umfangreiche Studien aus
verschiedenen Erdteilen belegt, ist es Ausdruck eines
allgemeinen Artensterbens von erdgeschichtlichem
Ausmaß: die sechsteMassenauslöschung in der Ära des
höheren Lebens. Diese ist allerdings menschengemacht
und nahmmit der industriellen und der Agrarrevolution
vor ca. 200 Jahren ihren Anfang. Die Erkenntnisse der
Resilienzforschung zeigen, dass der Verlust an gene-
tischer Vielfalt und die Überfrachtung der Ökosyste-
me mit Nährstoffen die planetaren Grenzen noch um
ein Mehrfaches stärker belasten als der Klimawandel.
Dieser ist also nicht die einzige und schon gar nicht die
wirkungsmächtigste ökologische Bedrohung für die Ge-
sellschaft.
Dabei sind die vielfältigen Ursachen und Verursacher
schon lange beschrieben und wurden teilweise schon
vor über 150 Jahren erkannt. In unseren Breiten sind
es vor allem anderen die Intensivierung des Landbaus
und der Flächenfraß. Doch schon 1885 beklagte ein
Naturforscher, dass ialle mündlichen wie schriftlichen
Auslassungen über die großen allgemeinenNachtheilel
kein Gehör fänden. Daran hat sich bis heute leider nur
wenig geändert. Artensterben, Nährstoffüberfrachtung
und Klimawandel gehören daher gemeinsam ganz nach
oben in jede umweltpolitische Debatte (national wie
international). Ohne eine echte Wende hin zu nachhal-
tiger Lebensweise und Subventionen ausschließlich für
naturverträglichesWirtschaften werden unsere Kinder
und Enkel eine bittere Rechnung begleichen müssen.
AS
Professorin Dr. Heike Feldhaar ist Leiterin Populationsökologie der
Tiere am Lehrstuhl Tierökologie I an der Universität Bayreuth, Mitglied
im Leitungsgremium und Direktorin des Bayreuther Zentrum für
Ökologie und Umweltforschung BayCEER. Ihr Forschungsschwerpunkt
sind soziale Insekten. (HF)
Professorin Dr. Ingrid Kögel-Knabner erforscht Bildung, Zusammenset-
zung und Eigenschaften der organischen Substanz in Böden. Seit 1995
hat sie den Lehrstuhl für Bodenkunde an der Technischen Universität
München inne. Sie ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften und Mitglied im Bioökonomierat der Bundesregierung. Seit
2015 wird sie regelmäßig in der Liste der »Highly Cited Researchers«
geführt und zählt damit zu den weltweit am häufigsten zitierten
Wissenschaftler*innen. 2018 wurde sie mit dem Bayerischen Maximi-
liansorden ausgezeichnet. (IKK)
Professorin Dr. Susanne S. Renner hat den Lehrstuhl für Systemati-
sche Botanik und Mykologie an der Ludwig-Maximilians-Universität
München inne. Sie ist Direktorin des Botanischen Gartens und der
Botanischen Staatssammlung sowie Mitglied der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften. (SR)
Professor Dr. Josef H. Reichholf ist ein deutscher Zoologe, Evolutions-
biologe und Ökologe. Er war von 1974 bis 2010 Sektionsleiter Orni-
thologie der Zoologischen Staatssammlung München. Reichholf ist
Autor zahlreicher Bücher über Natur und Naturschutz, Ökologie,
Evolution, Klima- und Umweltschutz. 2007 erhielt er den Sigmund-
Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung. Reichholf ist Mitglied der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. (JR)
Professor Dr. Michael Schrödl ist Leiter der Weichtiersektion (Mollusken)
der Zoologischen Staatssammlung München (SNSB) und lehrt an der
Ludwig Maximilians-Universität München. Im Bereich der Meeresbio-
logie ist Schrödl bekannt für seine Forschung an Meeresnacktschnecken.
Als Buchautor setzt sich Schrödl für biologische Vielfalt und
taxonomische Grundlagenforschung ein. (MS)
Dr. Andreas Segerer ist Schmetterlingsforscher an der Zoologischen
Staatssammlung München (Microlepidoptera Bayerns, Systematik und
Taxonomie der Phycitinae). In seiner Funktion als Präsident der
Münchner Entomologischen Gesellschaft wird er von den Medien
zum aktuellen Verschwinden von Biene & Co. vielfach angefragt. (AS)
1
2
3
4
Zum Weiterlesen:
Schrödl, Michael:
Unsere Natur stirbt: Warum
jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden und
das verheerende Auswirkungen hat.
Komplett
Media, 2018
Reichholf, Josef H.:
Schmetterlinge. Warum sie
verschwinden und was das für uns bedeutet.
C. Hanser, München, 2018
Segerer, Andreas H., Rosenkranz, Eva:
Das große
Insektensterben. Was es bedeutet und was wir
jetzt tun müssen,
Oekom Verlag, 2018
Zech, Wolfgang, Schad Peter, Hintermeier-Erhardt
Gerd:
Böden der Welt – Ein Bildatlas.
Springer
Spektrum, 2014
Maniola Jurtina, Großes Ochsenauge
Foto: Heike Feldhaar
















