
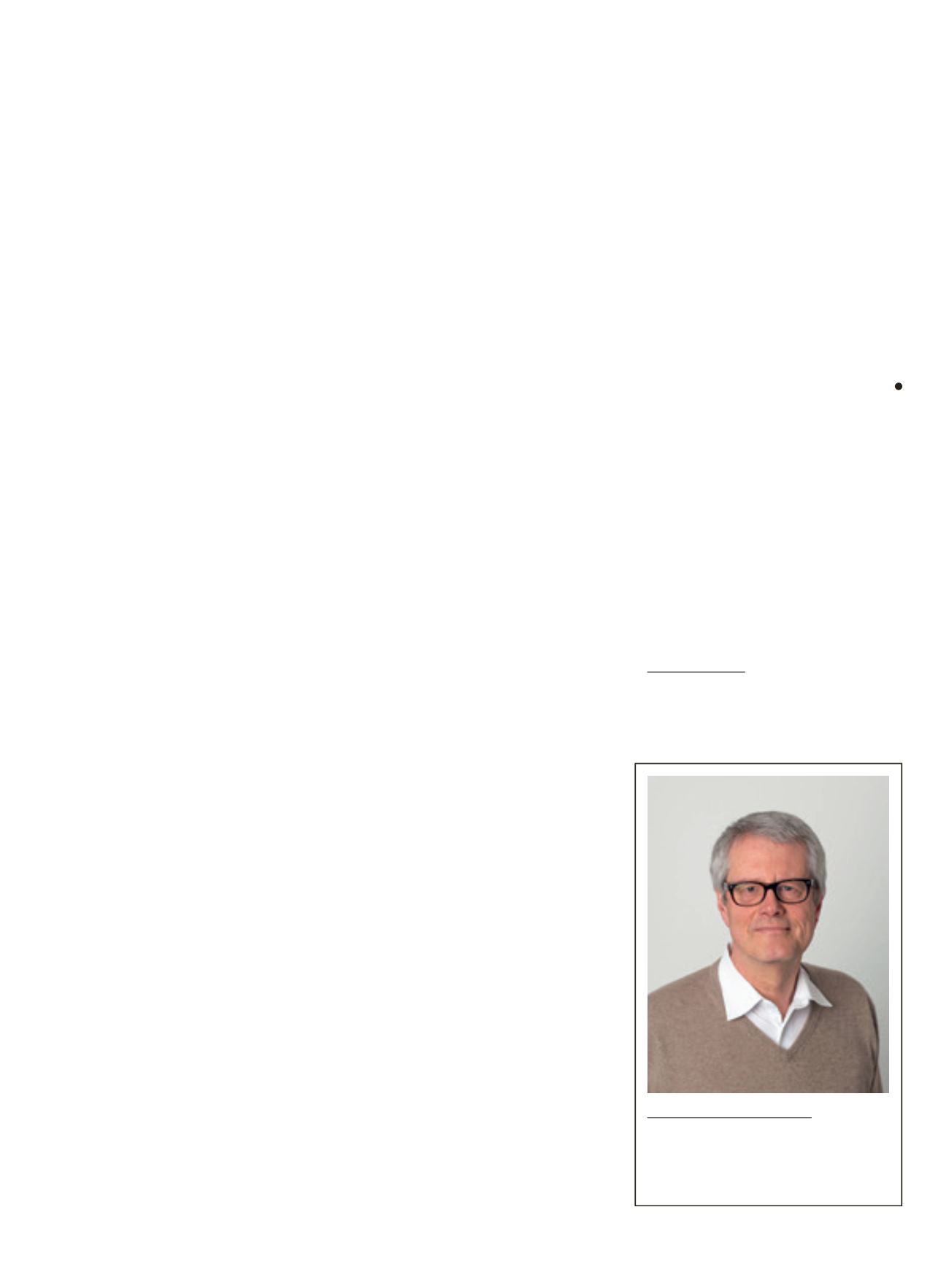
37
Museen digital
gesteuert werdenkönnen. Gemündet ist dieseErkenntnis inhäufig
klar formulierten »digitalen Strategien«, die das Digitale als »a
dimension of everything« betrachten, wie es kurz und bündig in
der Londoner Tate Gallery heißt. Das
Konservieren
der Werke als
eines der Hauptaktionsfelder des Museums ist heute ohne com-
putergesteuerte Analyseverfahren ganz undenkbar geworden, die
Dokumentation
erfolgt sinnvollerweise in speziell designtenDaten-
banken, die
Erforschung
derKunst wird immer umfangreicher von
digitalen tools und Suchmöglichkeiten unterstützt, und selbst für
das
Sammeln
stehen meist sehr professionell gestaltete Verkaufs-
kataloge der Kunsthändler, Galerien und Auktionshäuser zur Ver-
fügung. Hinzu kommen die erheblichen Produktivitätsgewinne,
die durch eine konsequente und wohl organisierte Anwendung
digitalerKommunikations- undVerwaltungsmittel zu erzielen sind.
(2) Auch der fünfte der vom International Council of Museums
(ICOM) definierten Aufgabenbereiche des Museums wird heu-
te mehr und mehr vom Digitalen beeinflusst, zumindest wenn
man die Praxis mancher angelsächsischer und niederländischer
Museen betrachtet – was im Übrigen natürlich nicht heißt, dass
hier inzwischen vielfach nicht auch Institute in anderen Ländern
nachgezogen hätten. Gemeint ist die
Präsentation
, die neben der
klassischen Ausstellung der Werke in den Räumen des Museums
immer stärker elektronische, vornehmlich imInternet angesiedelte
Begleitinstrumente vorsieht. Das beginnt schonbei den
Bilddaten-
banken
der eigenen Besitztümer, die in vielen Fällen – genannt
seiendasClevelandMuseumof Art unddasMetropolitanMuseum
in New York, aber auch die großen Londoner Institute und das
Rijksmuseum in Amsterdam – den kompletten Bestand im Netz
präsentieren oder in absehbarer Zukunft präsentieren werden. Im
Rahmen einer konsequenten Open Access-Politik werden hier so-
gar hochqualitativeReproduktionenderWerke einerÖffentlichkeit
zurVerfügung gestellt, die vielfach ausdrücklichdazu aufgefordert
wird, von diesen Reproduktionen einen möglichst phantasievol-
len Gebrauch zu machen. Ganz in den Hintergrund tritt hier die
anderswo weiterhin dominierende Vorstellung, der Gebrauch der
Werke müsse kontrolliert und monetarisiert werden. Beides wohl
inderGewissheit, dass zu viel Kontrolle kontraproduktiv und allzu
viel Geldmit demVerkauf der Reproduktionsrechte auch nicht zu
verdienen ist.
NebenderVeröffentlichung derBildreproduktionenund -daten
imInternet aber stehenweitere digitale Instrumente,mit denendie
Museen ihr Publikum anlocken, binden, unterhalten und bilden
wollen. In das Feld der
Gamification
gehörenmannigfaltige Spiele,
bei denen z. B. das Getty Museum in Los Angeles hervorsticht.
Spielen gilt hierzulande immer noch als tendenziell unseriös (trotz
Schiller); anderswo hat man längst entdeckt, dass es kaum eine
effektivere Bildungs- und Unterhaltungstechnik gibt. Englische
Museen haben zuweilenmehrereMillionen follower bei den
Social
Media,
über die sie nicht nur zuVeranstaltungen einladen, sondern
die sie virtuos zur Publikumsbindung nutzen. Am bedeutsamsten
scheintmir die dort vielfach zubeobachtendeBereitschaft, denBei-
trag des Publikums in einemproduktivenundnicht nur rezeptiven
Sinne ernst zu nehmen. Über diverse
Crowdsourcing
-Projekte,
die von der Annotierung von Kunstwerken bis zum selbstverant-
wortlichen, aber idealerweise von Museumskustoden begleiteten
Organisieren von Ausstellungen reichen können, hat sich hier eine
erstaunliche Aktivität entwickelt, die sich auch davon nicht ab-
schrecken lässt, dass der Erfolg nicht in jedem Fall gesichert ist.
Wie gesagt, auch in Deutschland tut sich seit einiger Zeit in der
Museumsszene etwas. Es bleiben aber genügend Möglichkeiten,
hier noch weiter aufzuholen. Zunächst einmal müsste sich eine
Aufgeschlossenheit allerMitarbeiter*innenderMuseengegenüber
demDigitalen einstellen, es reicht nicht aus, solcherart Aktivitäten
auf bestimmte Abteilungen, etwa die Pressestelle, zu begrenzen.
Zweitens müsste in einer längeren Reflexionsphase sorgfältig ge-
plant werden, in welche Richtung man denn insgesamt gehen will.
Jede geplanteAktivitätmuss daraufhinbefragtwerden, ob sie nach-
haltig sein kann, Schnellschüsse verbieten sich. Drittens sollten
synergetische Potenziale genutzt werden. Anstatt jetzt eine eigene
Datenbank aufzulegenwäre z. B. zu überlegen, ob es nicht viel ein-
facher und kostengünstiger ist, in der cloud zu dokumentieren.
A propos kostengünstig: Was dabei wie immer unverzichtbar ist,
dürfte das Geld sein. Mit der Digitalisierung geht ein Paradigmen-
wechsel einher. Und den gibt es nicht umsonst.
Professor Dr. Hubertus Kohle ist Kunsthis-
toriker an der LMU München mit starken
Interessen in der digitalen Kunstgeschichte.
@hkohle
#digitalarthistory
blog.arthistoricum.netScreenshot linke Seite: Datenbank des
Rijksmuseum/Amsterdam
rijksmuseum.nl/en/search?f=1&p=1&ps=12&st=Objects&ii=0
Crowd-curated exhibition am Brooklyn
Museum/Nw 2008
artstuffmatters.files.
wordpress.com/2010/08/8-8-08-073.jpgDatenbank des Rijksmuseum/Amsterdam
rijksmuseum.nl/en/search?q=rem-brandt&v=&s=&ii=0&p=1
Getty Museum Games
getty.edu/gettygames/detectivesZum Weiterlesen:
Kohle, Hubertus:
Museen digital. Eine
Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss
an die Zukunft.
Heidelberg University
Publishing, Heidelberg, 2019
Foto: Heidrun Hertel
















